Kursthemen
-
-
-
Es gibt zahlreiche Kompetenzen, die wir erlernen können, um souverän mit Diversität und Interkulturalität umzugehen. In diesem Modul werden wir Ihr Wissen und Können in diesem Bereich auffrischen und erweitern. Gleichzeitig möchten wir Sie einladen, Ihre eigene Haltung zu reflektieren, um neue Impulse im Alltag umzusetzen.
-

Übung 1 Zukunftskompetenzen (Modul 1)
Bevor es hier richtig losgeht: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 1 Zukunftskompetenzen (Modul 1) im Workbook.
-

Die VUKA WELT
Stellen Sie sich vor, Sie steuern ein Boot auf einem stürmischen Meer, die Wellen wechseln ständig ihre Richtung, der Wind weht unvorhersehbar und Nebel versperrt die Sicht. So fühlt sich die Welt für viele heute an – voller Überraschungen, Unsicherheiten und ständigem Wandel. Es beschreibt auch was wir als VUKA-Welt bezeichnen.
- V für Volatilität:
Dies bedeutet, dass sich Dinge schnell und unerwartet verändern. Märkte, Technologien oder soziale Trends können in kürzester Zeit schwanken, was es schwierig macht, langfristige Vorhersagen zu treffen. - U für Unsicherheit:
In einer unsicheren Welt sind viele Faktoren schwer vorhersehbar. Es gibt oft keine klaren Antworten, und wir wissen nicht immer, was die Zukunft bringt. Entscheidungen müssen unter Bedingungen getroffen werden, bei denen das Ergebnis nicht sicher ist. - K für Komplexität:
In einer komplexen Welt gibt es viele miteinander verbundene Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen. Entscheidungen sind oft nicht einfach, da verschiedene Faktoren berücksichtigt werden müssen, die sich ständig verändern und miteinander interagieren. - A für Ambiguität: Ambiguität beschreibt die Mehrdeutigkeit und Unklarheit, die uns umgibt. Informationen sind häufig vage oder widersprüchlich, und es gibt oft keine klaren Richtlinien, wie man bestimmte Situationen angehen soll.
In einer VUKA-Welt ist es wichtig und notwendig, flexibel, anpassungsfähig und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Viele dieser Veränderungen zeigen sich dabei ganz konkret im Umgang mit Menschen: durch internationale Zusammenarbeit, unterschiedliche kulturelle Prägungen, vielfältige Lebensrealitäten und Perspektiven.
Diese Vielfalt macht unsere Arbeits- und Lebenswelten komplexer, aber auch reicher. Interkulturelle und Diversitätskompetenzen unterstützen uns dabei, in dieser Vielschichtigkeit Orientierung zu behalten, respektvoll zu kommunizieren und auch unter Unsicherheit handlungssicher zu agieren. Hier kommen also die Themen Interkulturalität und Diversität ins Spiel, aber was ist damit überhaupt gemeint?
- V für Volatilität:
-
Was ist Diversität?
Diversität/ Diversity bedeutet Vielfalt. Es beschreibt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen - zum Beispiel in Bezug auf unsere Fähigkeiten, Geschlecht oder Religion.
Vielfalt ist ein natürlicher Bestandteil jeder Gesellschaft und jeder Organisation: Wir kommen aus verschiedenen Ländern, werden im Laufe der Zeit älter und unterscheiden uns auch in weiteren Dimensionen von Diversität.Weil gesellschaftlich keine Gleichstellung herrscht und bestimmte Personengruppen Diskriminierung erfahren müssen, ist gesetzlicher Schutz notwendig. Rechtlich geschützt sind so weit sechs Dimensionen – die sogenannten „Big 6“. Dazu zählen Migrationsgeschichte und Nationalität, Geschlecht, Behinderung, Religion und Weltanschauung, Alter und die sexuelle Identität. Häufig wird auch auf die Big 7 verwiesen, welche soziale Herkunft miteinschließen, auch wenn diese Dimension nicht rechtlich verankert ist. Die Big 6 werden als Persönlichkeitsmerkmale verstanden, die unveränderbar sind.
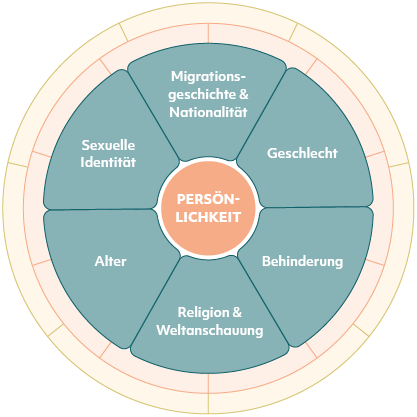
Quelle: Abbildung angelehnt an Gardenswartz und Rowe (2008): Four Layers of Diversity.
Was heißt rechtlich geschützt? Eine Diskriminierung oder Benachteiligung aufgrund einer der Big 6 Dimensionen ist verboten. Wenn das doch passiert, kann man sich dagegen wehren und rechtliche Schritte einleiten. Zum Beispiel: Wenn mir aufgrund meines Geschlechts ohne sachlichen Grund ein Job verweigert wird, ist das rechtlich unzulässig und könnte vor Gericht eingeklagt werden. Für solche Diskriminierungsfälle gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
 Kennen Sie schon das
AGG?
Kennen Sie schon das
AGG? Außer der Big 6 gibt es natürlich noch viele weitere auch veränderbare Dimensionen, in denen wir uns unterscheiden. Wie wir aufgewachsen sind, was wir gerne in unserer Freizeit machen, wo wir arbeiten, welche Ausbildung wir durchlaufen sind, wie lange wir schon in einer Organisation arbeiten. All diese Faktoren einzeln und in ihren Überschneidungen wirken sich auf die individuelle Perspektive auf das Leben jedes Einzelnen aus. Das, was sich für eine Person normal anfühlt, was für sie neu ist und worin sie Herausforderungen erlebt, kann für eine andere Person völlig gegenteilig sein. Es wirkt sich auch darauf aus, wie jeder einzelne Mensch durch sein Umfeld wahrgenommen wird.
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht dies und zeigt auf, welche vielfältigen Dimensionen auf das Individuum und damit auf die Persönlichkeit einwirken.
Quelle: Abbildung in Anlehnung an Charta der Vielfalt e.V. (o.J.) nach Gardenswartz/Rowe 2003.
Was ist Interkulturalität?
Verschiedene Kulturen sind Teil unserer gesellschaftlichen Diversität. Unter Kulturen verstehen wir nicht nur unterschiedliche Nationalitäten und Religionen, eine Kultur bildet sich überall dort, wo auch immer mehrere Menschen zusammenkommen. Dies kann somit auch eine Organisationskultur sein oder die gelebte Kultur eines Sportvereins. Interkulturalität bezeichnet die konkrete Begegnung und Zusammenarbeit von Menschen, die kulturell unterschiedlich geprägt sind, beispielsweise wenn Mitarbeitende mit verschiedenen beruflichen Sozialisationen und Werthaltungen in einem internationalen Projektteam Entscheidungen treffen müssen.
Wir bemerken, wenn wir neu in einer Gruppe oder einem Kollektiv sind. Wir kennen dann zum Beispiel die expliziten oder impliziten Regeln noch nicht, wir sprechen womöglich anders oder tragen nicht das gleiche Trikot. Das kann in einem neuen Sportverein sein, einer neuen Universität, einem neuen Land oder einer neuen Nachbarschaft.
-

Übung 2 Reflexionsfrage (Modul 1)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 2 Reflexionsfrage (Modul 1) im Workbook.
-
Was ist eine inklusive und gleichberechtigte Gesellschaft?
In einer inklusiven Gesellschaft hat jeder Mensch die Möglichkeit gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2025). Dies beinhaltet, dass Menschen nicht aufgrund ihrer individuellen Identitätsmerkmale ausgeschlossen werden. Ob wir gesellschaftliche Teilhabe erleben, darf also nicht von unserem Alter, unserem Geschlecht, unseren Fähigkeiten etc. abhängig sein. Da dies noch keine gesellschaftliche Realität ist, bedeutet Inklusion auch Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass alle aktiv miteinbezogen werden und Barrieren zur Teilhabe abgebaut werden.
Inklusion in einer Organisation
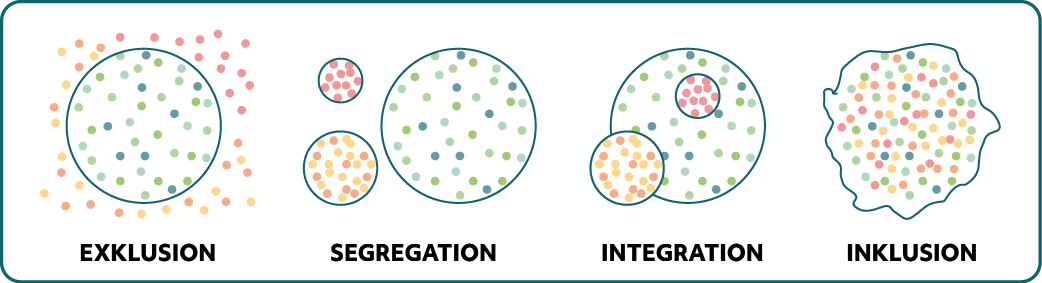
Drücken Sie auf Play, um die Erklärung für das Schaubild zu hören.Transkript zum Hörspiel
Das Schaubild zeigt vier Szenen, die den Umgang einer Organisation mit Unterschiedlichkeit verdeutlichen.
Im ersten Szenario, der Exklusion, sind einzelne Personen vollständig ausgeschlossen - sie gehören nicht zur Gruppe und nehmen nicht an gemeinschaftlichen Aktivitäten teil.
Im zweiten Szenario, der Segregation, bestehen zwar mehrere Gruppen nebeneinander, doch sie bleiben getrennt. Es gibt kaum Austausch.
Im dritten Szenario, der Integration, sind alle Personen im selben Raum, doch die Verantwortung für Anpassung an das bestehende System liegt bei den Einzelnen, die sich in das System eingliedern möchten. Die Gruppe bleibt im Kern unverändert, Unterschiede werden nur begrenzt berücksichtigt.
Das vierte Szenario zeigt schließlich Inklusion. Hier bilden Vielfalt und Verschiedenheit den normalen Zustand. Alle Personen sind gleichberechtigt beteiligt, und Strukturen sind so gestaltet, dass jede*r unabhängig von individuellen Voraussetzungen mitwirken kann.Dieses Schaubild macht deutlich: Inklusion bedeutet nicht nur, dass alle anwesend sind, sondern dass Barrieren abgebaut werden, damit alle Personen unabhängig von individuellen Voraussetzungen gerecht teilhaben können.
Doch was meint eine gerechte Teilhabe in der Arbeitswelt? Gleichheit vs. Gerechtigkeit
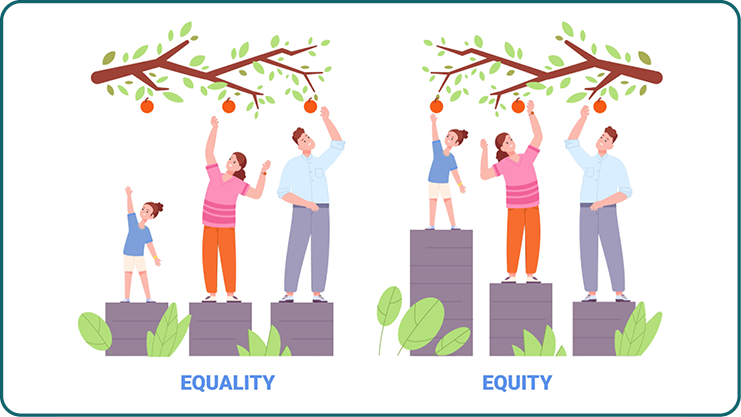
Drücken Sie auf Play, um die Erklärung für das Schaubild zu hören.
Transkript zum HörspielDas Bild zeigt drei unterschiedlich große Personen, die versuchen, an die Äpfel eines Baumes zu gelangen.
Im Bild links, das Equality, also Gleichheit, darstellt, erhält jede Person den gleichen Hocker.
Obwohl die Ressourcen gleich verteilt sind, können nur zwei Personen die Äpfel erreichen.
Die kleinste Person bleibt benachteiligt, weil ihre individuellen Voraussetzungen nicht berücksichtigt werden.
Im Bild rechts geht es um Equity, also Gerechtigkeit oder Chancengleichheit.
Hier erhalten die Personen unterschiedlich hohe Hocker, genau so, wie sie es benötigen, um alle den Baum mit den Äpfeln zu erreichen. Die Unterstützung wird also bedarfsgerecht, nicht gleich verteilt und dadurch wird gleiche Teilhabe ermöglicht.
Der Unterschied zwischen Equality und Equity verdeutlicht, dass gleiche Behandlung nicht automatisch zu Gerechtigkeit führt. Erst wenn individuelle Unterschiede anerkannt und gezielt ausgeglichen werden, entstehen faire Chancen für alle. -

Jetzt wird’s praktisch! Im nächsten Kapitel haben Sie die Gelegenheit, verschiedene praxisorientierte Übungen zu durchlaufen, die Ihnen helfen werden, Ihre Kompetenzen in den Bereichen Interkulturalität und Diversität weiterzuentwickeln und anzuwenden.
Der Identitätskreis – Übung für Selbstreflexion
Wie divers bin ich? Aus welcher Perspektive erlebe ich die Welt? Was ist für mich normal? Was ist für mich fremd? All das können wir besser verstehen, wenn wir reflektieren als Teil welcher Gruppen oder Kollektive wir uns verstehen.
-

Übung 3 Identitätskreis (Modul 1)
Mit dem Identitätskreis wird das Thema verständlicher und lässt sich direkt auf das eigene Leben anwenden, bearbeiten Sie hierfür Übung 3 Identitätskreis (Modul 1) im Workbook.
-
Was haben Sie durch die Übung herausgefunden? Jeder Mensch ist unterschiedlich und gehört gleichzeitig mehreren Gruppen oder Kollektiven an. Diese Mehrfachzugehörigkeit wird als Multikollektivität bezeichnet. Sie bedeutet, dass unsere Identität nicht nur durch eine einzige Zugehörigkeit definiert wird (z.B. Nationalität, Geschlecht oder Religion), sondern sich aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt. Diese Aspekte können sich auf die Diversity-Dimensionen sowie auf weitere soziale, kulturelle, berufliche oder persönliche Bereiche beziehen. Die Kombination dieser Zugehörigkeiten ist individuell und einzigartig.
Perspektivwechsel - Was ist schon normal?
Was wir als „normal“ empfinden, hängt stark von unserer eigenen Perspektive ab, zum Beispiel von den Gruppen und Erfahrungen, die unseren Identitätskreis prägen. Da jede Person unterschiedlichen sozialen, kulturellen und persönlichen Bezugspunkten angehört, ist auch das Verständnis von Normalität individuell.
Wenn wir nur unsere eigene Sichtweise als Maßstab heranziehen, fällt es schwer, andere Lebenswelten nachzuvollziehen - Missverständnisse und Vorurteile entstehen dann leicht.
Kennen sie die Kontakthypothese nach Allport (1954)? Diese besagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen durch positiven Kontakt mit Mitgliedern unterschiedlicher Gruppen mögliche Vorurteile und Feindseligkeiten abgebaut werden - oder auch einfach andere ‚Normalitäten‘ vertrauter werden.
-

Übung 4 Kontakthypothese (Modul 1)
Schreiben Sie in Ihrem Workbook Übung 4 Kontakthypothese (Modul 1) drei neue Orte, Events, Gruppen, die sie entdecken möchten, auf.
-
Ambiguitätstoleranz – Mehrdeutigkeit aushalten
Mehrdeutigkeit und Unsicherheit gehören zum interkulturellen Alltag. Situationen verlaufen nicht immer so, wie wir es gewohnt sind. Manche Verhaltensweisen erscheinen uns unlogisch oder irritierend – etwa, wenn Gesprächspartner*innen auf eine Frage nicht direkt antworten oder Entscheidungen auf Teammeetings vertagt werden.
Beispiel: In einem internationalen Teammeeting wartet ein neuer Kollege mit seiner Wortmeldung, bis er ausdrücklich dazu aufgefordert wird.
Anfangs wirkt das auf einige Teilnehmende passiv. Doch im Nachhinein stellt sich heraus, dass in seiner Kommunikationskultur Zurückhaltung und Respekt vor der Leitung positiv bewertet werden.
Ambiguitätstoleranz (Frenkel-Brunswik 1949) hilft hier, Verhalten nicht vorschnell zu interpretieren, sondern neugierig zu hinterfragen. Sie ist eine zentrale Voraussetzung interkultureller Kompetenz.Ambiguitätstoleranz bedeutet:
- Unterschiedliche Perspektiven nebeneinander bestehen lassen zu können,
- Widersprüche auszuhalten, ohne vorschnell ein Urteil zu fällen,
- Offen zu bleiben für
alternative Deutungen und Lösungen.
Diese Haltung hilft, vorschnelle Schlussfolgerungen zu vermeiden und stattdessen zu fragen: Welche kulturellen, sprachlichen oder situativen Gründe könnten dieses Verhalten erklären?
Ambiguitätstolerante Menschen sehen Unsicherheit als Chance zum Lernen. Sie wissen: Mehrdeutigkeit ist kein Problem, sondern ein normaler Bestandteil von Vielfalt.Interkulturelle Sensibilität – Genau hinschauen statt Schubladen denken
Interkulturelle Sensibilität ist die Fähigkeit, feine Unterschiede in Kommunikation und Verhalten wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Sie ist das Gegenstück zu vorschnellen Schubladen, die wir im Alltag oft unbewusst öffnen. Im Modul 2 lernen Sie, dass unser Denken durch unbewusste Voreingenommenheiten (Unconscious Biases) beeinflusst wird. Interkulturelle Sensibilität hilft, diese Denkmuster zu erkennen, zu hinterfragen und dadurch offener sowie gerechter zu agieren. Je sensibler wir wahrnehmen, desto seltener greifen wir auf stereotype Annahmen zurück.
-

Übung 5 Zitronenübung (Modul 1)
Bitte bearbeiten Sie Übung 5 Zitronenübung (Modul 1) in Ihrem Workbook.
-
Auflösung zur Übung (nach Bergmann et al. 2017):
Wir assoziieren Zitronen mit ähnlichen Merkmalen: Sauer, gelb, rund etc. Auf den ersten Blick wirken alle Zitronen im Korb gleich. Doch bei genauerem Hinsehen stellen wir individuelle Unterschiede fest und die zu Beginn gewählten Merkmale beschreiben Ihre ausgewählte Zitrone nicht vollständig. Wenn Sie sich Ihre Zitrone später wiedererkennen konnten, zeigt das: Die pauschale Aussage „alle Zitronen sehen gleich aus“ stimmt nicht.
Was bedeutet das in unserem Kontext?
Äußere Merkmale sind häufig der Ausgangspunkt für Schubladendenken und Kategorisierungen. Auch im (Arbeits-)alltag greifen wir auf Verallgemeinerungen über Gruppen zurück. Dadurch werden wir allerdings einzelnen Personen, die Teil einer Gruppe sind, nicht gerecht. -

Einstellung & Haltung entwickeln
Um interkulturelle und Diversity-Kompetenzen zu entwickeln und auszubauen, ist neben dem Wissen und Können das Wollen essenziell. Hierbei handelt es sich um die persönliche Haltung, sich der eigenen Werte bewusst zu sein, Vielfalt als Bereicherung zu begreifen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.
Eine diversitätssensible Haltung zeigt sich im universitären Alltag beispielsweise in der Art, wie wir kommunizieren, zuhören, Entscheidungen treffen oder Kolleg*innen und Studierende unterstützen.
Die Grundfrage lautet daher: Was motiviert Sie, Diversität und Interkulturalität aktiv zu leben?
-

Übung 6 Die eigene Haltung (Modul 1)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 6 Die eigene Haltung (Modul 1) im Workbook.
-
-
-
In unserem Alltag treffen wir unzählige Entscheidungen – viele davon blitzschnell, ohne bewusst darüber nachzudenken.
Diese schnellen Entscheidungen beruhen häufig auf sogenannten unbewussten Denkmustern, den Unconscious Biases.
Sie entstehen durch Erfahrungen, Sozialisation und kulturelle Prägung - und beeinflussen unsere Wahrnehmung von Menschen, Situationen und Fähigkeiten, ohne dass wir es bemerken. -
Was ist Unconscious Bias?
Unbewusste Vorurteile, auch als Unconscious Bias bekannt, sind kognitive Wahrnehmungsverzerrungen, die das Denken und Verhalten beeinflussen, oft basierend auf gesellschaftlichen Stereotypen. Sie beeinflussen die Urteilsbildung im Privaten wie im Beruflichen. Damit Personen nicht unbewusst aufgrund von Merkmalen wie Geschlecht, Hautfarbe oder Alter unterschiedlich behandelt werden, ist es entscheidend, sich der eigenen Vorurteile sowie der dahinterliegenden Mechanismen bewusst zu sein und Anstrengungen zu unternehmen, um diese zu erkennen und zu überwinden.
Woher kommen Wahrnehmungsverzerrungen?
2-Systeme-Theorie menschlichen Entscheidungsverhaltens nach KahnemannDer Psychologe und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, Daniel Kahneman, beschreibt in seinem Konzept „Dual Process Theory“ (2011) zwei Arten des Denkens (Gilovich et al. 2002):
System 1:
schnell, automatisch, intuitiv, unbewusst, mühelos, unreflektiert
→ es hilft uns, Alltagssituationen effizient zu bewältigen.
Beispiel: Sie sehen ein Straßenschild → Sie wissen sofort, was es bedeutet, ohne darüber nachzudenken.System 2:
langsam, bewusst, analytisch, angestrengt, reflektiert, aufwendig
→ es kommt zum Einsatz, wenn wir gezielt nachdenken oder Informationen kritisch prüfen müssen.
Beispiel: Sie lesen einen Bewerbungsbogen aufmerksam und vergleichen Qualifikationen.Unser Gehirn greift bevorzugt auf System 1 zurück, denn das spart Energie, indem es Informationen vereinfacht und in Schubladen sortiert. Das ist zunächst ganz normal, hilfreich und sogar notwendig, um unseren Alltag zu meistern. Problematisch wird es jedoch, wenn diese Vereinfachungen zu Vorannahmen führen, die Menschen benachteiligen - etwa durch stereotype Zuschreibungen. Unconscious Biases sind also kognitive Abkürzungen, die im Alltag sinnvoll erscheinen können, jedoch auch ungewollt zu Diskriminierung und Ausschlüssen führen, zum Beispiel bei Einstellungen, Leistungsbeurteilungen, im Arbeitsalltag oder in der Lehre.
-
Begriffserklärungen
Stereotyp
unvollständiges Wissen über wahrgenommene soziale Gruppen
→ Entstehung durch soziale Kategorisierungen, durch Eigen- und FremdgruppenbildungVorurteil
mit Emotionen behaftete Stereotype
→ Positive oder negative Einstellungen gegenüber Gruppen(-Angehörigen)Unbewusste Vorurteile/ Wahrnehmungsverzerrungen
Vorurteile, die im Alltag dabei helfen, schneller auf Situationen reagieren zu können
→ Fehlerhafte und starre Verallgemeinerung (positiv wie negativ)
Eigene Darstellung nach Junker, N.M., Hernandez Bark, A.S., Heimrich, J. (2022). Stereotype und Vorurteile, der Social Identity Approach und Intergruppenkontakt. In: Genkova, P. (eds) Handbuch Globale Kompetenz. Springer, Wiesbaden.
-
Beispiel für unbewusste Vorurteile
Folgende unbewusste Vorurteile sind gerade im Arbeitskontext besonders relevant (Vedder 2019, 2022):
1. Halo-Effekt (Halo Effect)
Der Halo-Effekt tritt auf, wenn auffallende Merkmale einer Person zu einer generell positiven Bewertung führen. Personen sollten objektiv anhand ihrer Gesamtheit bewertet werden, unabhängig von einzelnen herausragenden Merkmalen.
→ Beispiel: Eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat tritt selbstbewusst auf und kommuniziert eloquent in Besprechungen. Kolleg*innen gehen daher davon aus, dass sie sehr zuverlässig und fachlich versiert ist, obwohl ihre Aktenbearbeitung wiederholt unvollständig ist.
2. Affinitätsbias (Affinity Bias)
Affinitätsverzerrung, auch Ähnlichkeitsverzerrung, beschreibt die Neigung von Menschen, sich mit anderen verbunden zu fühlen, die ähnliche Interessen, Erfahrungen und Hintergründe haben. Um Affinitätsverzerrungen zu vermeiden, ist es ratsam, bewusst auf mögliche Ähnlichkeiten zu achten und zwischen persönlichen Vorlieben und den erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu unterscheiden.
→ Beispiel: Bei der Auswahl von studentischen Hilfskräften bevorzugt eine Mitarbeiterin Bewerber*innen, die an der gleichen Uni im Ausland studiert haben wie sie selbst.
3. Attributionsverzerrung (Attribution Bias)
Attributionsverzerrung, oder Attribution Bias, ist die Tendenz, das Verhalten einer Person aufgrund früherer Beobachtungen und Interaktionen zu beurteilen. Es ist wichtig, im Vorfeld klärende Fragen zu stellen und Missverständnisse zu klären, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen.
→ Beispiel: Eine ausländische Kollegin erscheint mehrmals zu spät zu Meetings. Der Vorgesetzte schließt daraus auf Unzuverlässigkeit, ohne nachzufragen, ob es an Sprachbarrieren, Arbeitsbelastung oder technischen Problemen liegt.
4. Konformitätsverzerrung (Conformity Bias)
Konformitätsverzerrung beschreibt die Tendenz, dass Menschen sich dem Verhalten ihrer Umgebung anpassen.
→ Beispiel: In einer Besprechung kritisieren mehrere Kolleg*innen die Arbeitsweise einer neuen Mitarbeiterin als „zu langsam“. Eine Kollegin, die positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht hat, äußert sich nicht, um nicht gegen die Mehrheitsmeinung anzusprechen.
5. Der Horn-Effekt (Horns Effect)
Der Horn-Effekt, als Gegenteil zum Halo-Effekt, tritt auf, wenn einer Person aufgrund eines Merkmals negative Eigenschaften zugeschrieben werden.
→ Beispiel: Ein neuer internationaler Kollege macht einen sprachlichen Fehler in der Vorstellungsrunde – daraufhin wird ihm generell geringe Kompetenz unterstellt.
6. Altersdiskriminierung (Ageism)
Altersdiskriminierung kann sowohl ältere Menschen als auch jüngere betreffen, wobei ältere häufiger von Vorurteilen gegenüber ihrer Leistungsfähigkeit und jüngere häufig aufgrund von Stereotypen gegenüber ihrer Generation betroffen sind.
→ Beispiel: Ein älterer Bewerber wird im Auswahlprozess ausgeschlossen mit der Begründung, er könne sich vermutlich nicht mehr an die digitale Infrastruktur der Abteilung gewöhnen.
7. Namensverzerrung (Name Bias)
Namensverzerrung ist weit verbreitet und führt dazu, dass Bewerber*innen mit bestimmten Namenstypen benachteiligt werden, insbesondere solche mit nicht-deutschsprachigem Ursprung.
→ Beispiel: Im Bewerbungsverfahren werden Kandidat*innen mit „typisch deutschen“ Namen häufiger eingeladen, während solche mit ausländisch klingenden Namen trotz gleicher Qualifikationen oft übersehen werden.
Lookism (Beauty Bias, Height Bias)
Lookism ist weit verbreitet. So werden attraktive Personen oft als erfolgreicher und kompetenter wahrgenommen. Studien zeigen, dass attraktive und große Menschen tendenziell höhere Gehälter und bessere Jobangebote erhalten.
→ Beispiel: Eine Bewerberin mit Kopftuch wird als „weniger offen“ oder „weniger teamfähig“ wahrgenommen, obwohl es keine Hinweise darauf gibt – lediglich basierend auf ihrem äußeren Erscheinungsbild.
-
Unbewusste Vorurteile im Arbeitsalltag und im Universitären Kontext
- Unbewusste Vorurteile
zeigen sich nicht nur im Alltag, sondern auch im Arbeitsalltag.
In einer Studie der Ökonomin Doris Weichselbaumer aus dem Jahr 2016 zeigte sich, dass eine fiktive Bewerberin mit deutschem Namen in 18,8 % der Fälle eine positive Rückmeldung auf ihr Bewerbungsschreiben erhielt. Trug dieselbe fiktive Frau mit identischen Bewerbungsunterlagen einen türkischen Namen, sank die Rückmeldequote auf 13,5 %. Wenn sie zusätzlich auf dem beigelegten Foto ein Kopftuch trug, lag die Quote nur noch bei 4,2 %.
- Ein weiteres Beispiel zeigt sich im sogenannten Mini-Me-Effekt:
Im Oktober 2024 waren die Vorstände an der Frankfurter Börse überwiegend homogen – 80 % der Vorstandsmitglieder waren Männer, 75 % Deutsche und 75 % hatten einen wirtschafts- oder ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund. Der Mini-Me-Effekt beschreibt, dass CEOs dazu tendieren, Teammitglieder auszuwählen, die ihrem eigenen Profil ähneln, etwa im Namen oder im beruflichen Werdegang. So gibt es mehr Vorstandsmitglieder mit dem Vornamen Christian, als es weibliche Mitglieder im Vorstand gibt. Frauenquoten werden unter anderem eingesetzt, um diesen selbstreproduzierenden Kreislauf aufzubrechen und eine vielfältigere Führungskultur zu fördern. (Quelle: Allbright-Bericht 2024: Mind the Gap: Deutschland bleibt beim Frauenanteil im Top-Management weit hinter Großbritannien)
- Auch für den universitären
Kontext gibt es Beispiele für Unconscious Biases:
Eine Studie von 2019 zeigte, dass die Akzeptanzraten für Artikel in einer biowissenschaftlichen Zeitschrift höher waren, je ähnlicher sich die Autor*innen und die Gutachter*innen waren. In dieser Studie waren die Gutachter*innen US-amerikanisch. Die Wahrscheinlichkeit, zur Artikeleinreichung eingeladen zu werden, lag für US-amerikanische Autor*innen bei 39,2 %, für deutsche bei 29,3 % und für chinesische bei 12,6 %. Dies deutet auf einen Affinitäts- oder Ähnlichkeitsbias hin, bei dem Gutachter*innen eher Artikel von Personen mit einem ähnlichen Hintergrund akzeptieren.
- Unbewusste Vorurteile
zeigen sich nicht nur im Alltag, sondern auch im Arbeitsalltag.
-

Übung 7a Reflexion (Modul 2)
Pause im Kurs: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 7a Reflexion (Modul 2) im Workbook.
-
Erste Lösungsansätze und Empfehlungen
Persönliche Haltung und Reflexion
Das eigene Bewusstsein fördern und regelmäßig selbst reflektieren, ob und wie sehr die eigenen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmuster voreingenommen sind. Hierfür ist es sinnvoll, die Übung 7a im Workbook nach einiger Zeit zu wiederholen und erneut auf die Ergebnisse zu blicken.
Eigene Sensibilisierung im Arbeitsalltag schaffen und die Bereitschaft mitbringen, mit Kolleg*innen zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Konkrete Handlungsideen für den Arbeitsalltag lauten hierbei wie folgt:
 In Teamrunden gezielt nach anderen Perspektiven fragen:
In Teamrunden gezielt nach anderen Perspektiven fragen:
„Gibt es noch eine andere Sichtweise, die wir bisher nicht gehört haben?“
Oder: „Mir ist aufgefallen, dass wir den Vorschlag von Frau X vorhin schnell verworfen haben. Vielleicht lohnt es sich, noch einmal darauf zu schauen – unabhängig davon, von wem er kam.“ Eigene Unsicherheiten offen benennen:
Eigene Unsicherheiten offen benennen:
„Ich merke, dass ich spontan skeptisch bin – vielleicht sollten wir das noch einmal sachlich prüfen.“
Oder: „Ich frage mich gerade, ob wir bei den Bewerbungen unbewusst stärker auf bestimmte Lebensläufe reagieren. Wollen wir unsere Kriterien noch einmal gemeinsam durchgehen?“
 Lernimpulse teilen:
Lernimpulse teilen:
Nach einer Schulung oder Lektüre einen kurzen Impuls im Team geben, z. B.
„Ich habe neulich etwas zum Halo-Effekt gelesen – vielleicht ist das auch für unsere Situation relevant.“Standardisierte und diskriminierungssensible Auswahlverfahren
Leitfäden für Bewerbungsgespräche (z. B. für Stipendien, Auslandssemester)
Anwendung des Vier-Augen-Prinzips
Trennung von Informationssammlung (im Gespräch) und Bewertung (nach dem Gespräch)
Strukturelle Verankerung von Diversity & Inclusion
- Aufbau von Unterstützungsangeboten für unterrepräsentierte Gruppen
- Förderung von Diversität in Studierenden- und Mitarbeitendenvertretungen
- Berücksichtigung von D&I-Aspekten in Förder- und Projektanträgen
- Überprüfung von Bildmaterial
auf der Homepage und in Werbemitteln
(z. B. für Stipendien, Auslandsprogramme) in Hinblick auf die Repräsentation
vielfältiger Hintergründe: Welche Personengruppen werden auf welche Art dargestellt?
-

Übung 7b Lösungsansatz (Modul 2)
Pause im Kurs: Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 7b Lösungsansatz (Modul 2) im Workbook.
-
-
-
An Universitäten begegnen sich täglich Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen - Studierende, Forschende, Verwaltungsangestellte und externe Gäste. Sie bringen verschiedene Sprachen, Kommunikationsstile, Arbeitsweisen und Werte mit. Diese Vielfalt ist eine große Bereicherung - sie kann aber auch zu Missverständnissen führen, wenn Erwartungen oder Ausdrucksweisen unterschiedlich sind.
Ziel interkultureller Kompetenz ist nicht, alle Unterschiede zu kennen oder festgelegte Verhaltensregeln zu lernen. Es geht vielmehr darum, Verständnis, Offenheit und die sogenannte Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, also die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Mehrdeutigkeit umgehen zu können.
-

Übung 8 Reflexion (Modul 3)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 8 Reflexion (Modul 3) im Workbook.
-
Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation
Interkulturelle Kommunikation und interkulturelle Kompetenz gehören eng zusammen, bezeichnen aber Unterschiedliches – und genau diese Unterscheidung ist wichtig, damit der Lernprozess klar bleibt.Interkulturelle Kommunikation beschreibt zunächst den Prozess: Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten treten miteinander in Austausch – verbal, nonverbal oder implizit. Dabei bringen sie unterschiedliche Erwartungen, Werte, Kommunikationsstile und Bedeutungszuschreibungen ein. Wo diese Unterschiede aufeinandertreffen, entstehen Missverständnisse, Irritationen, aber auch Lern- und Verständigungsmöglichkeiten.
Interkulturelle Kompetenz bezeichnet dagegen die Fähigkeit, mit solchen Situationen konstruktiv umzugehen. Sie zeigt sich nicht im bloßen Wissen über „andere Kulturen“, sondern in konkretem Handeln: in der Art, wie Menschen zuhören, nachfragen, Perspektiven reflektieren, Konflikte bearbeiten oder Entscheidungen gemeinsam aushandeln (Straub/Weidemann/Weidemann 2007; Lüsebrink 2016).
Man kann es so zusammenfassen:- Interkulturelle Kommunikation = der Raum, in dem kulturelle Differenzen sichtbar werden.
- Interkulturelle Kompetenz = das Repertoire an Fähigkeiten, das Menschen benötigen, um in diesem Raum respektvoll, verständigungsorientiert und situationsangemessen zu handeln.

Damit diese Kompetenz entstehen und wachsen kann, greifen zwei Einflussgrößen ineinander:In interkulturellen Situationen wird diese Verzahnung besonders deutlich: Unterschiedliche kulturelle Prägungen wirken auf Kommunikationsweisen, und genau dadurch entstehen sowohl Herausforderungen als auch Chancen für Verständigung. Interkulturelle Kompetenz zeigt sich dann darin, wie Menschen diese Situationen gestalten – etwa in Gesprächen, digitalen Kommunikationsformen oder der Zusammenarbeit in diversen Teams.- Kommunikation: Bedeutungen entstehen im Austausch zwischen Menschen – ausdrücklich, unausgesprochen oder zwischen den Zeilen.
- Kultur: Sie bildet den Rahmen, der Wahrnehmung, Verhalten und Interpretation prägt, ohne Menschen dabei auf stereotype Zuschreibungen festzulegen.
Um zu verstehen, wie interkulturelle Kommunikation funktioniert, lohnt sich ein Blick auf den Kulturbegriff selbst, denn er ist die Grundlage dafür, wie wir Unterschiede wahrnehmen und deuten.Was ist Kultur?
Im Alltag verstehen viele unter Kultur etwas, das mit Ländern, Traditionen oder Sprachen zu tun hat. In der Wissenschaft ist der Kulturbegriff jedoch viel umfassender. Demnach beschreibt Kultur die Gesamtheit der gelernten und geteilten Muster von Denken, Fühlen und Handeln, die das Zusammenleben in einer Gemeinschaft prägen (Harris 1999).
Kultur zeigt sich in sichtbaren Formen, etwa in Sprache, Kleidung, Umgangsformen oder Organisationen – aber auch in unsichtbaren Anteilen, wie Werte, Einstellungen, Kommunikationsstile und Erwartungen.
Ein bekanntes Bild dafür ist der „Kultur-Eisberg“ (Prutek/Grabe 2024): Nur ein kleiner Teil ist sichtbar (z. B. Sprache, Verhalten), während der größere Teil unter der Oberfläche liegt (z. B. Werte, Normen, Denkweisen).

Bildquelle: https://www.interkultureller.blog/begruessung-interkulturell-ist-der-feste-haendedruck-normalDer Kulturbegriff kann dabei eng oder weit, geschlossen oder offen verstanden werden (Kretzenbacher 1992):
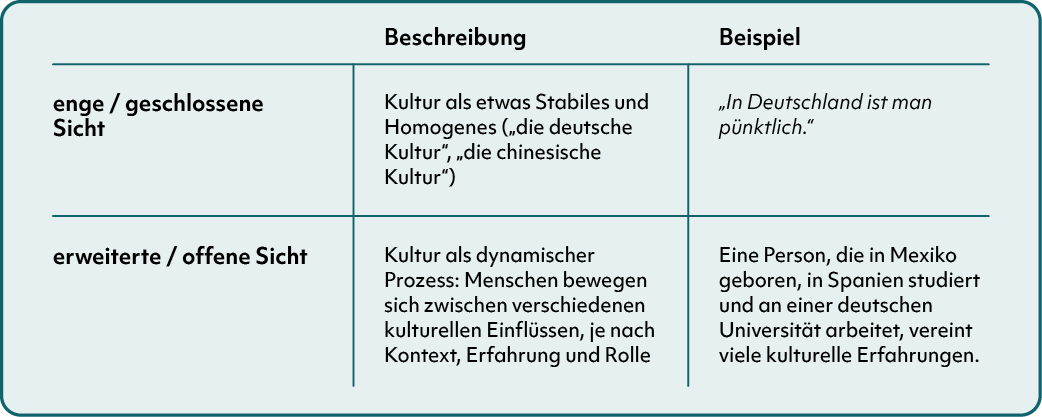
Der geschlossene Kulturbegriff geht davon aus, dass Kulturen feste Grenzen haben und klar voneinander unterscheidbar sind.
Der offene Kulturbegriff betrachtet Kultur als wandelbar und durchlässig. Menschen übernehmen, vermischen und entwickeln kulturelle Elemente weiter.Die offene Sichtweise entspricht heutigen Realitäten in global vernetzten Hochschulen. Sie erlaubt, Unterschiede nicht als Barrieren, sondern als Ressource für Lernen und Innovation zu sehen. Kultur ist also kein starres System, sondern ein lebendiger Prozess, in dem Menschen Bedeutungen aushandeln und sich gegenseitig beeinflussen.
- Interkulturelle Kommunikation = der Raum, in dem kulturelle Differenzen sichtbar werden.
-

Übung 9 Selbstverständlichkeiten (Modul 3)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 9 Selbstverständlichkeiten (Modul 3) im Workbook.
-
Multi-, Inter- und Transkulturalität
Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, wird sichtbar, wie vielfältig Menschen denken, fühlen und handeln. Entscheidend ist dann, wie wir diese Unterschiede wahrnehmen: als Trennung, als Begegnung – oder als wechselseitiges Lernen.
Die folgenden Begriffe helfen, diese Perspektiven zu unterscheiden:
Der deutsche Philosoph Wolfgang Welsch (1997/2017) beschreibt Transkulturalität als zeitgemäße Sichtweise, weil sie der heutigen, global vernetzten Realität entspricht. Kulturelle Einflüsse sind durch die Globalisierung heute nicht mehr klar voneinander zu trennen – sie überlagern und verbinden sich im Alltag vieler Menschen.
 Drei Beispiele:
Drei Beispiele:- Eine Mitarbeiterin
der Universitätsverwaltung, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber
regelmäßig mit internationalen Studierenden auf Englisch kommuniziert und in
Projekten mit Partneruniversitäten in Asien arbeitet.
-
Ein Studierender,
der in Jordanien geboren wurde, in Frankreich aufgewachsen ist und nun an einer
deutschen Hochschule forscht – und dabei Arbeitsstile und Kommunikationsformen
aus verschiedenen Kontexten kombiniert.
-
Die Mensa, in der
Studierende aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam essen und dabei Speisen,
Sprachen und Rituale vermischt werden: von italienischer Pasta mit koreanischer
Soße bis hin zu Gesprächen in mehreren Sprachen am selben Tisch.
Diese Beispiele zeigen: Transkulturalität bedeutet, dass kulturelle Grenzen zunehmend durchlässig werden. Menschen verbinden Elemente verschiedener kultureller Kontexte und schaffen daraus neue Formen des Miteinanders – im Alltag, in der Arbeit und in der Wissenschaft.
Warum sprechen wir dann von interkultureller und nicht von transkultureller Kommunikation?
Der Begriff interkulturelle Kommunikation ist historisch älter und hat sich in Wissenschaft und Praxis stärker etabliert. In der Hochschulpraxis wird deshalb meist von interkultureller Kommunikation gesprochen, weil dieser Begriff:
- ... besser an bestehende Konzepte und Trainings anschließt (z. B. interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen),
- ... verständlicher und anschlussfähiger für Menschen ist, die sich erstmals mit dem Thema befassen,
- ... und den Begegnungsaspekt
betont – also genau das, was in Universitäten mit internationalen Studierenden
und Kolleg*innen täglich geschieht.
Kurz gesagt: „Interkulturell“ lenkt den Blick auf die Begegnung zwischen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. „Transkulturell“ erweitert diese Sicht und erinnert uns daran, dass Grenzen zwischen Kulturen oft fließend sind. Beide Begriffe ergänzen sich – und gemeinsam helfen sie, die Realität einer vielfältigen, global vernetzten Universität besser zu verstehen.
- Eine Mitarbeiterin
der Universitätsverwaltung, die in Deutschland aufgewachsen ist, aber
regelmäßig mit internationalen Studierenden auf Englisch kommuniziert und in
Projekten mit Partneruniversitäten in Asien arbeitet.
-
Makro-, Meso- und Mikroebene der Interkulturellen Kommunikation
Wenn Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen miteinander kommunizieren, wirkt im Hintergrund viel mehr mit, als auf den ersten Blick sichtbar ist.
Kommunikation – ob im Büro, per E-Mail oder in einem Gespräch – ist immer Teil eines größeren Systems: Sie wird geprägt von gesellschaftlichen Normen, von den Strukturen einer Organisation und von individuellen Erfahrungen (Moghaddam/Covalucci 2016).Diese drei Ebenen – Makro, Meso und Mikro – beeinflussen, ob Verständigung gelingt oder möglicherweise scheitert:
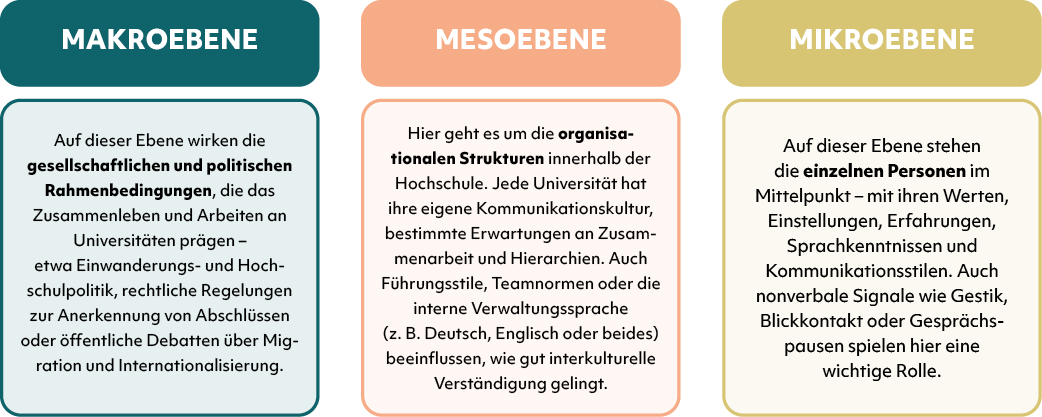
In der Praxis bedeutet das: Wenn Missverständnisse entstehen, liegt die Ursache nicht immer bei einer Person, sondern kann auf jeder dieser Ebenen zu finden sein.
Interkulturelle Kompetenz bedeutet deshalb auch, Situationen „von außen“ zu betrachten und zu fragen: Auf welcher Ebene entsteht dieses Missverständnis – und was kann ich selbst zum besseren Verständnis beitragen?
Ein Konflikt im Gespräch mit einer internationalen Kollegin kann beispielsweise durch organisatorische Abläufe (Mesoebene), durch unterschiedliche gesellschaftliche Prägungen (Makroebene) oder durch persönliche Kommunikationsgewohnheiten (Mikroebene) beeinflusst sein. -
Kulturelle Unterschiede beschreiben
Perspektivwechsel ist der erste Schritt, um interkulturelle Situationen besser zu verstehen.
Der nächste Schritt besteht darin, Kulturen bewusst zu beschreiben, ohne dabei zu verallgemeinern oder zu bewerten. Der Ansatz des niederländischen Kulturwissenschaftlers Fons Trompenaars (1993) unterstützt genau diesen Prozess: Er bietet eine strukturierte Methode, um kulturelle Unterschiede analytisch und reflektiert zu betrachten.Trompenaars Modell (in Anlehnung an die Arbeiten von Geert Hofstede, z.B. Hofstede 1991) vergleicht Kulturen entlang verschiedener Dimensionen, etwa:
- Kommunikationsstil (direkt vs. indirekt)
- Verhältnis zu Hierarchie (flach vs. stark ausgeprägt)
- Umgang mit Zeit und Regeln (flexibel vs. strukturiert)
- Bedeutung von Beziehungen (aufgabenorientiert vs. beziehungsorientiert)
- Entscheidungsfindung (individuell vs. konsensorientiert)
- Umgang mit Unsicherheit (hohe vs. geringe Ambiguitätstoleranz)
- Selbstverständnis (individualistisch vs. kollektivistisch)
- Emotionsausdruck (zurückhaltend vs. ausdrucksstark)
- Konfliktstil (konfrontativ vs. harmonieorientiert)
- Raum- und
Distanzverhalten (enger persönlicher Raum vs. größerer Abstand in Interaktionen)
Diese Dimensionen sind keine festen Kategorien, sondern Orientierungshilfen. Sie machen sichtbar, dass Menschen und Organisationen unterschiedliche Tendenzen haben – und dass kulturelle Einflüsse sich verändern können.
Dieser Ansatz hilft, Unterschiede zu erkennen, ohne sie zu werten und gemeinsame Lösungen zu entwickeln, z. B. durch transparente Zeitplanung und regelmäßige Abstimmung. Das Ziel ist also nicht, „richtiges“ Verhalten zu definieren, sondern Verständnis und Gesprächsfähigkeit zu fördern.
-

Übung 10 Selbsteinschätzung kultureller Unterschiede (Modul 3)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 10 Selbsteinschätzung kultureller Unterschiede (Modul 3) im Workbook.
-
Diversity-Dimension: Nationalität und Migrationsgeschichte
Die Diversity-Dimension Nationalität und Migrationsgeschichte spielt in der interkulturellen Zusammenarbeit an Universitäten eine zentrale Rolle.
In Hochschulen begegnen sich Menschen aus vielen Ländern, mit unterschiedlichen Muttersprachen, kulturellen Prägungen und Bildungsbiografien. Diese Vielfalt ist ein großer Gewinn – sie bringt neue Perspektiven, Innovation und internationale Vernetzung.
Gleichzeitig können sich daraus Herausforderungen in der Kommunikation, im Arbeitsstil oder in Erwartungen an Zusammenarbeit ergeben.Nationalität, Migrationsgeschichte, ethnische Herkunft – und Identität
Begriffe wie Nationalität, Migrationsgeschichte, ethnische Herkunft und Kultur werden im Alltag oft gleichgesetzt, meinen aber Unterschiedliches:

In der Praxis überschneiden sich diese Ebenen häufig. Menschen können mehrere kulturelle Identitäten haben oder sich je nach Situation unterschiedlich positionieren. Herkunft und Migration beeinflussen, aber bestimmen nicht, wer wir sind. Die eigene Identität ist immer im Wandel und entsteht im Austausch mit anderen.
-
Nationalität und Herkunft im universitären Alltag
An deutschen Hochschulen zeigt sich kulturelle Vielfalt u.a. in:
- internationalen Studierenden, Forschenden und Lehrenden,
- mehrsprachigen Teams und Verwaltungseinheiten,
- internationalen Forschungsprojekten,
- und globalen
Netzwerken, z.B. Erasmus-Partnerschaften, europäischen Hochschulallianzen oder
EU-Projekten.
Diese Vielfalt wirkt sich auf viele Arbeitsbereiche aus – von Bewerbungsprozessen über Kommunikation mit internationalen Gästen bis zur Gestaltung interner Abläufe (z. B. in der Personalabteilung oder Studierendenverwaltung).
 Ein Beispiel: Eine diversitätssensible Verwaltung erkennt solche Hürden und sucht aktiv nach Lösungen – etwa durch zweisprachige Formulare, Schulungen oder klare Zuständigkeiten für internationale Anliegen.
Ein Beispiel: Eine diversitätssensible Verwaltung erkennt solche Hürden und sucht aktiv nach Lösungen – etwa durch zweisprachige Formulare, Schulungen oder klare Zuständigkeiten für internationale Anliegen.- In der Studienberatung wird Englisch als
Arbeitssprache genutzt. Ein Formular liegt aber nur auf Deutsch vor. Das Ergebnis:
Internationale Studierende fühlen sich unsicher, und Beratende müssen
zusätzliche Zeit für Erklärungen aufbringen.
-
(Unbewusste) Stereotype und Zuschreibungen vermeiden
Die Diversity-Dimension Nationalität und Migrationsgeschichte ist besonders anfällig für Stereotype und unbewusste Zuschreibungen (Bolten 2019). Solche Annahmen entstehen schnell – etwa, wenn jemand aufgrund eines Akzents, eines Namens oder bestimmter Verhaltensweisen in eine „Schublade“ gesteckt wird.
 Zwei Beispiele:
Zwei Beispiele:- Ein Bewerber mit arabischem Namen wird im Bewerbungsgespräch auf seine „guten Deutschkenntnisse“ angesprochen, obwohl er in Deutschland geboren wurde.
- Ein Studierender aus
Ghana wird gefragt, ob er ein Austauschsemester macht – dabei ist er im Master
immatrikuliert.
Solche Zuschreibungen sind meist nicht böse gemeint, können aber das Gefühl von Zugehörigkeit und Wertschätzung beeinträchtigen. Interkulturelle Kompetenz bedeutet daher auch, eigene Erwartungen zu hinterfragen und Raum für individuelle Geschichten zu lassen.
-

Übung 11 Reflexion (Modul 3)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 11 Reflexion (Modul 3) im Workbook.

 Wichtig:
Wichtig:
Nationalität und Migrationsgeschichte sind zentrale Aspekte von Vielfalt, aber sie erklären nicht allein das Verhalten von Menschen. Im Hochschulkontext geht es daher nicht darum, kulturelle Unterschiede zu kategorisieren, sondern Sensibilität und Offenheit zu entwickeln: Menschen sind mehr als ihre Herkunft – sie sind Kolleg*innen, Studierende, Forschende, Vorgesetzte und Teil eines gemeinsamen Lern- und Arbeitsraums.
Deshalb heißt Vielfalt erkennen, Menschen in ihrer Individualität zu sehen, nicht nur in ihrer Herkunft. -
Erste Lösungsansätze und Empfehlungen für den Umgang mit Internationalen Mitarbeitenden und Studierenden
Im interkulturellen Miteinander gibt es keine einfachen Regeln, die immer gelten. „Dos & Don’ts“ klingen zwar praktisch, führen aber oft zu Verallgemeinerungen – etwa, wenn Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft bestimmte Verhaltensweisen zugeschrieben werden.
Interkulturelle Kompetenz bedeutet daher nicht, zu wissen, wie „die anderen“ sind,
sondern lernen zu können, mit Unterschieden und Unsicherheiten umzugehen.
Der Schlüsselbegriff dafür ist Ambiguitätstoleranz – also die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit und Widersprüche auszuhalten, ohne vorschnell zu bewerten. Interkulturelle Kompetenz heißt also, in Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben – und nicht, alle Antworten zu kennen.
Doch wie kann das im Hochschulalltag konkret aussehen? Die folgenden Empfehlungen zeigen, wie interkulturelle Sensibilität und Ambiguitätstoleranz im Arbeitskontext gestärkt werden können.1. Reflexion statt Reaktion
- Beobachten Sie Ihre eigenen Erwartungen und spontanen Bewertungen in interkulturellen Situationen.
- Fragen Sie sich: Welche Annahmen stecken hinter meiner Reaktion?
- Eine kurze Pause zum Nachdenken hilft oft, Missverständnisse zu
vermeiden.
2. Neugierig bleiben und nachfragen
- Anstatt Unsicherheiten zu vermeiden, können Sie sie aktiv ansprechen – freundlich, offen, interessiert.
- Beispiel: „Ich merke, dass wir unterschiedlich an die Sache herangehen – können Sie mir kurz erklären, wie Sie das in an ihrer Universität handhaben?“
3. Strukturen schaffen, die Vielfalt unterstützen
- Übersetzte Formulare, zweisprachige E-Mail-Vorlagen oder interkulturelle Schulungen erleichtern Zusammenarbeit.
- Einheitliche Kommunikationsleitfäden helfen, Erwartungen transparent zu machen – ohne starre Vorgaben.
4. Ambiguitätstoleranz trainieren
- Nicht jede Situation ist eindeutig. Versuchen Sie, Widersprüche als Lernchance zu sehen.
- Unterschiedliche Auffassungen über Pünktlichkeit, Feedback oder Entscheidungsprozesse müssen nicht sofort „gelöst“ werden – sie können Ausgangspunkte für gegenseitiges Lernen sein.
5. Beziehungen gestalten – nicht nur Prozesse
- Vertrauen entsteht über Zeit, Respekt und echtes Interesse.
- Kleine Gesten – z. B. die Einladung zum gemeinsamen Mittagessen oder das bewusste Nachfragen bei stilleren Kolleg*innen – fördern ein inklusives Miteinander.
6. Strukturelle Verantwortung ernst nehmen
- Vielfalt ist nicht nur eine persönliche, sondern auch eine organisationale Aufgabe.
- Teams, Leitungen und Personalabteilungen können Diversität
gezielt fördern, etwa durch Mentoringprogramme, transparente Auswahlprozesse
und interkulturell offene Kommunikationskultur.
Interkulturelle Kompetenz ist keine Checkliste, sondern eine lebenslange Lernhaltung.
Sie beginnt mit Neugier und Respekt und wächst durch Erfahrung, Reflexion und Offenheit.
Wer Vielfalt nicht als Problem, sondern als Potenzial versteht, trägt zu einer inklusive(re)n und lernenden Universitätskultur bei.Es geht also nicht darum, alles zu wissen, sondern darum, bereit zu sein, Fragen zu stellen.
-
-
-
Religion und Weltanschauung sind zentrale, aber häufig unterschätzte Dimensionen von Diversität. Sie prägen Werte, ethische Haltungen und Formen des Zusammenlebens. In einer pluralen Gesellschaft begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen: vom streng gläubigen Menschen bis zur überzeugten Atheistin, vom kulturell geprägten Glauben bis zur bewusst nicht-religiösen Haltung.
Im Hochschulkontext zeigt sich diese Vielfalt in alltäglichen Situationen: bei der Gestaltung von Arbeitszeiten und Feiertagen, in der Mensa, in der Lehre, bei Diskussionen über Ethik, Werte oder gesellschaftliche Verantwortung. Religion und Weltanschauung können Quelle von Orientierung, Gemeinschaft und Sinn sein, aber auch Anlass für Missverständnisse oder Konflikte, wenn sie auf unterschiedliche Überzeugungen treffen.
Eine diversitätssensible Hochschule berücksichtigt religiöse und weltanschauliche Vielfalt und schafft Räume, in denen unterschiedliche Überzeugungen respektvoll nebeneinander bestehen können.
-
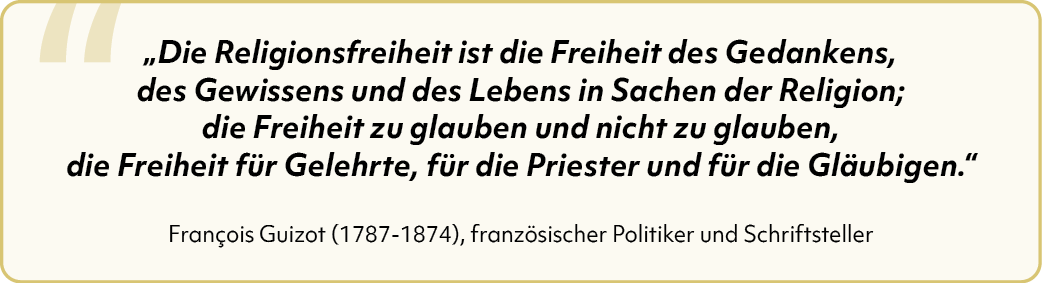
-
Religion und Weltanschauung
Die Diversity-Dimension Religion und Weltanschauung umfasst individuelle Glaubenssysteme, ethische Leitbilder und Sinnzusammenhänge (Pickel 2024). So werden diese beiden Konzepte grundsätzlich unterschieden:
- Religion
beschreibt ein System von Überzeugungen, Ritualen und Gemeinschaftsformen, das
sich auf Transzendenz, Heiligkeit oder göttliche Ordnung bezieht. Sie
vermittelt Zugehörigkeit, Orientierung und moralische Maßstäbe.
- Weltanschauung
bezeichnet hingegen eine individuelle oder kollektive Haltung zur Welt. Sie
kann religiös, humanistisch, agnostisch oder atheistisch geprägt sein. Auch
säkulare Überzeugungen (z. B. Humanismus, Rationalismus, Naturphilosophie)
fallen darunter.
Beide Begriffe stehen für grundlegende Dimensionen menschlicher Identität und beeinflussen Werte, Wahrnehmung und Handeln.
Ein kurzer Blick in die Geschichte der Weltreligionen
Religionen prägen die Menschheitsgeschichte seit ihren Anfängen (Deutschlandfunk 2009). Frühformen des Glaubens wie Natur- und Ahnenkulte finden sich bereits in steinzeitlichen Gesellschaften. Aus diesen entwickelten sich im Lauf der Jahrtausende komplexe religiöse Systeme.
- Religion
beschreibt ein System von Überzeugungen, Ritualen und Gemeinschaftsformen, das
sich auf Transzendenz, Heiligkeit oder göttliche Ordnung bezieht. Sie
vermittelt Zugehörigkeit, Orientierung und moralische Maßstäbe.
-
Im Globalen Süden prägen Religionen bis heute das soziale, kulturelle und politische Leben in vielfältiger Weise. In vielen Regionen sind religiöse Traditionen eng mit Alltagskultur, Gemeinschaft und Identität verknüpft. Neben großen Weltreligionen wie Christentum, Islam, Hinduismus oder Buddhismus bestehen dort auch zahlreiche indigene und lokale Glaubensformen. Diese Vielfalt zeigt, dass Religionen im Globalen Süden nicht nur spirituelle Orientierung bieten, sondern auch Trägerinnen von sozialem Zusammenhalt, Bildung und Widerstandskraft sind.
Im Verlauf der Globalisierung und zum Teil gewaltvollen Missionierung traten Religionen zunehmend in Austausch, Dialog und auch Konflikt miteinander. Gleichzeitig entstanden säkulare Weltanschauungen, die Sinn und Ethik ohne Bezug auf Transzendenz begründen. Heute zeigt sich weltweit eine große Vielfalt religiöser und nichtreligiöser Lebensformen, die zur kulturellen Diversität moderner Gesellschaften beitragen.
-
Religiöse Vielfalt im Hochschulkontext
Hochschulen sind Räume gelebter Vielfalt, in denen Menschen mit unterschiedlichen religiösen, weltanschaulichen und kulturellen Hintergründen zusammenkommen (Rötting 2014). Diese Unterschiedlichkeit eröffnet Lern- und Begegnungsmöglichkeiten, die über fachliches Wissen hinausgehen. Wenn Hochschulen religiöse und weltanschauliche Diversität bewusst wahrnehmen, respektieren und in ihre Bildungskultur integrieren, kann daraus eine wertvolle Ressource entstehen.
 Beispiele aus dem Hochschulalltag:
Beispiele aus dem Hochschulalltag:- Raumgestaltung und Infrastruktur:
Gebets- und Rückzugsräume, Speiseangebote in der Mensa (halal, koscher, vegetarisch, vegan) - Zeitliche Strukturen:
Rücksicht auf religiöse Feiertage, Fastenzeiten (z.B. Ramadan, Jom Kippur) oder Gebetszeiten - Lehre und Forschung:
Themen religiöser Vielfalt, Ethik, interkulturelle Kommunikation - Kommunikation und Haltung:
wertschätzender Umgang mit sichtbaren Symbolen (z.B. Kopftuch, Kreuz, Turban) und pluraler Sprache
In vielen Staaten gilt die Idee, dass der Staat und seine Institutionen religiös neutral handeln soll – also keine Religion bevorzugt oder benachteiligt. Dieses Prinzip wird jedoch unterschiedlich verstanden.
In Frankreich etwa ist die Laizität (laïcité) seit 1905 gesetzlich verankert. Sie bedeutet eine strikte Trennung von Staat und Religion: Der Staat soll weltanschaulich völlig neutral bleiben, und religiöse Symbole sind in öffentlichen Einrichtungen – vor allem an Schulen – weitgehend untersagt. Ziel ist die Gleichbehandlung aller Bürger*innen, unabhängig von Glauben oder Herkunft. Kritiker*innen sehen darin jedoch auch eine Gefahr, dass religiöse Identität aus dem öffentlichen Raum verdrängt wird.
In Deutschland gilt ebenfalls ein religiöses Neutralitätsgebot, allerdings in einer kooperativen Form. Der Staat erkennt Religionsgemeinschaften als Teil der Gesellschaft an und arbeitet in bestimmten Bereichen mit ihnen zusammen, etwa in der Seelsorge, im Religionsunterricht oder bei Feiertagen. Dabei muss er aber Ausgewogenheit und Gleichbehandlung wahren.
- Raumgestaltung und Infrastruktur:
-

Übung 12 (Modul 4.1)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 12 (Modul 4.1) im Workbook.
-
Hintergrund: Kreuzerlass und Kopftuchverbot
Der Kreuzerlass in Bayern (2018 / Debatte bis 2023):
In Bayern wurde per Verordnung beschlossen, dass in allen staatlichen Behörden Kreuze im Eingangsbereich hängen sollen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begründete dies mit dem Hinweis, das Kreuz sei kein religiöses, sondern ein kulturelles Symbol der „christlich-abendländischen Prägung“ Bayerns. Kritiker*innen warfen der Regelung jedoch vor, gegen das staatliche Neutralitätsgebot zu verstoßen, da das Kreuz eindeutig ein religiöses Symbol ist. Die Debatte wurde in den folgenden Jahren immer wieder aufgegriffen, zuletzt 2023, als Gerichte und Verbände die Vereinbarkeit des Erlasses mit der religiösen Neutralität erneut infrage stellten.
Das Kopftuchverbot für Schöffinnen (2025):
Im Jahr 2025 bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH), dass ehrenamtliche Richterinnen (Schöffinnen) kein Kopftuch im Gerichtssaal tragen dürfen. Begründet wurde dies mit der Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität der Justiz: Der Staat müsse nach außen hin unparteiisch wirken, auch durch das Auftreten seiner Vertreter*innen. Kritiker*innen sehen darin jedoch eine ungleiche Behandlung religiöser Symbole – insbesondere, wenn gleichzeitig christliche Symbole in staatlichen Räumen erlaubt bleiben. Aus Diversity-Perspektive stellt sich die Frage, ob Neutralität hier tatsächlich gewahrt oder ob bestimmte Glaubensformen unsichtbar gemacht werden.
Auch im Hochschulkontext gibt es Spannungsfelder im Umgang mit Religion und Weltanschauung. Hochschulen sind Orte der Begegnung, an denen Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, Wertvorstellungen und Ausdrucksformen zusammenkommen. Diese Vielfalt kann das akademische Miteinander bereichern, führt aber auch zu Herausforderungen, wenn Erwartungen und Sichtweisen aufeinandertreffen.
Typische Spannungsfelder sind:
- Religiöse Symbole im Lehrkontext:
Wie neutral darf oder soll das Lehrpersonal auftreten? Wann wird ein religiöses Symbol als persönliche Freiheit, wann als Einflussnahme wahrgenommen? - Meinungsfreiheit und Respekt:
Wie können religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen in kontroversen Diskussionen berücksichtigt werden, ohne wissenschaftliche Freiheit einzuschränken? Hier gilt es, respektvolle Debattenkultur und kritisches Denken in Einklang zu bringen. - Verwaltung und Gleichbehandlung:
Fragen nach Prüfungs- und Feiertagsregelungen, Speiseangeboten oder Kleidungsvorschriften zeigen, wie institutionelle Strukturen auf religiöse Vielfalt reagieren. Ein fairer und transparenter Umgang fördert Teilhabe und Gleichberechtigung. - Raumnutzung und Sichtbarkeit:
Auch Gebetsräume, stille Zonen oder religiöse Feiern auf dem Campus können Diskussionen über Gleichbehandlung und Neutralität auslösen.
Konflikte entstehen dabei selten aus Religion selbst, sondern meist aus Unsicherheit, fehlender Kommunikation oder mangelndem Wissen über religiöse Praktiken. Zentral ist daher, Räume für Dialog, Information und Reflexion zu schaffen. Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet, eigene Werte, Überzeugungen und Vorannahmen bewusst zu reflektieren – sowohl im Lehr- als auch im Verwaltungshandeln.
- Religiöse Symbole im Lehrkontext:
-

Übung 13 (Modul 4.1)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 13 (Modul 4.1) im Workbook.
-
Unbewusste Vorurteile/Stereotype im Universitären Kontext
Auch in Bezug auf Religion und Weltanschauung wirken unbewusste Vorannahmen, und zwar oft subtiler, als wir denken. Wir alle haben Bilder im Kopf, die durch gesellschaftliche Diskurse, Medien oder persönliche Erfahrungen geprägt sind: etwa, wie „religiös“ jemand erscheint, was „modern“ oder „traditionell“ gilt oder welche Werte wir bestimmten Glaubensrichtungen zuschreiben.
Solche impliziten Annahmen beeinflussen, wie wir Menschen wahrnehmen, ansprechen oder bewerten. Sie können dazu führen, dass Personen aufgrund ihrer sichtbaren oder vermuteten religiösen Zugehörigkeit anders behandelt oder beurteilt werden, ohne dass dies beabsichtigt ist.
Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet daher, diese inneren Bilder zu erkennen und zu hinterfragen: Welche spontanen Vorstellungen habe ich, wenn jemand religiöse Symbole trägt, sich auf seinen Glauben bezieht oder offen nichtreligiös positioniert? Solche Reflexionsprozesse sind ein wichtiger Schritt, um Wertschätzung und Gleichbehandlung unabhängig von Religion oder Weltanschauung zu fördern.
-

Übung 14 (Modul 4.1)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 14 (Modul 4.1) im Workbook.
-
Religion und Weltanschauung x Nationalität und Migrationsgeschichte
Die vorangehende Übung sollte auch gezeigt haben: Diversitätsdimensionen wirken nie isoliert, sondern überschneiden sich. Religion und Weltanschauung stehen oft in engem Zusammenhang mit Migrationsgeschichte, Geschlecht, Alter oder sozialer Herkunft.
 Ein Beispiel:
Ein Beispiel:
Aylin ist eine junge Muslimin und die erste Person in ihrer Familie, die studiert. Sie trägt ein Kopftuch, engagiert sich in der Studierendenvertretung und gilt in ihrem Umfeld als selbstbewusst und zielstrebig. In Seminaren wird sie jedoch immer wieder auf ihre Religion angesprochen – etwa, wie der Islam zu bestimmten gesellschaftlichen Fragen steht –, selbst wenn diese Themen nichts mit dem Seminarinhalt zu tun haben. Manche Kommiliton*innen ordnen ihre Argumente vorschnell als „religiös motiviert“ ein, während andere sie unbewusst als Repräsentantin „der Muslime“ ansehen. Gleichzeitig wird ihr Bildungserfolg häufig mit Bewunderung, aber auch mit Erstaunen kommentiert, weil sie „trotz Kopftuch so offen und aktiv“ sei.Dieses Beispiel zeigt, dass Diskriminierungserfahrungen häufig an der Schnittstelle mehrerer Diversitätsdimensionen entstehen – in diesem Beispiel sind das Religion, Geschlecht und soziale Herkunft. Eine diversitätssensible Hochschulkultur berücksichtigt solche Überschneidungen, um individuelle Erfahrungen sichtbar zu machen und faire Teilhabe zu ermöglichen.
„Take away“ und Challenge
- Religion und Weltanschauung sind zentrale
Bestandteile persönlicher Identität und gesellschaftlicher Vielfalt.
- Religionsfreiheit bedeutet, Glaube und Nicht-Glaube
gleichermaßen zu respektieren.
- Neutralität im Hochschulkontext heißt
Gleichbehandlung, nicht Unsichtbarmachung.
- Religiöse Vielfalt kann zu Perspektivwechsel,
ethischer Reflexion und sozialer Kompetenz beitragen.
- Dialog, Wissen und Offenheit sind die wirksamsten Mittel gegen Vorurteile und Missverständnisse.

Challenge Religion & Weltanschauung:
Achten Sie in den kommenden Wochen darauf, wie Religion und Weltanschauung in Ihrem Umfeld thematisiert werden, zum Beispiel bei Veranstaltungen, in den Medien oder in persönlichen Gesprächen. Werden bestimmte Perspektiven betont oder ausgeblendet?
- Religion und Weltanschauung sind zentrale
Bestandteile persönlicher Identität und gesellschaftlicher Vielfalt.
-
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien - Good Practice Guide „Religiöse
Vielfalt lokal gestalten“ der Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/good-practice-guide-religioese-vielfalt-lokal-gestalten-all-1
- ZDF-Dokumentation
„Macht der Götter – Weltgeschichte der Religionen“, https://www.zdf.de/video/dokus/macht-der-goetter-weltgeschichte-der-religionen-mit-christopher-clark-dokureihe-100/macht-der-goetter-weltgeschichte-der-religionen-der-goettliche-funke-wie-entstand-der-glaube-mit-christopher-clark-doku-100
- Religionsmonitor der
Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/religionsmonitor
- Leitfaden „Religiöse
Vielfalt am Arbeitsplatz – Grundlagen und Praxisbeispiele“ der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/religioese_vielfalt_am_arbeitsplatz.html
- Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid): https://fowid.de/
- Good Practice Guide „Religiöse
Vielfalt lokal gestalten“ der Bertelsmann-Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/good-practice-guide-religioese-vielfalt-lokal-gestalten-all-1
-
-
-
Soziale Herkunft ist eine zentrale – oft unterschätzte – Dimension von Diversität. Gemeint sind familiäre Bildungswege, ökonomische Ressourcen, kulturelles Kapital, Wohn- und Lebenslagen sowie Netzwerkzugänge. Diese Faktoren prägen Bildungsentscheidungen, Studienbedingungen und Übergänge in den Arbeitsmarkt und das Gefühl von Zugehörigkeit. Im Hochschulkontext zeigt sich das vor allem bei der Studienfinanzierung (z.B. BAföG, Nebenjobs), beim Zugang zu Informationen (z B. Mentoring, Netzwerke), bei Wohn- und Pendelzeiten oder in der Passung zu akademischen Milieus. Eine diversitätssensible Hochschule erkennt diese ungleichen Startbedingungen an und gestaltet Strukturen, die faire Teilhabe ermöglichen.
-
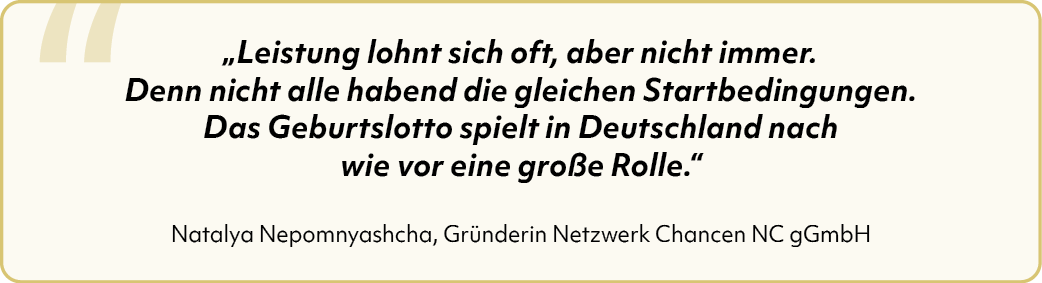
-
Was meint „soziale Herkunft“?
Die soziale Herkunft beschreibt die gesellschaftliche Ausgangsposition, aus der ein Mensch in das Bildungssystem und in den Beruf startet (Mafaalani 2021). Sie wird wesentlich durch den Bildungs- und Berufsstatus der Eltern, das Einkommen und Vermögen des Haushalts, aber auch durch kulturelle und soziale Ressourcen geprägt. Dazu gehören etwa das Wissen über akademische Abläufe, der Zugang zu unterstützenden Netzwerken oder die Möglichkeit, sich in bestimmten Milieus selbstverständlich zu bewegen.
Diese Faktoren beeinflussen den Bildungsweg von der Grundschule bis zur Hochschule, und das oft nicht durch einzelne Hürden, sondern durch ein Zusammenspiel vieler kleiner Unterschiede, die sich im Verlauf addieren. Soziale Herkunft ist also kein einzelnes Merkmal, sondern ein Bedingungsgeflecht aus Chancen und Begrenzungen, das sich in Bildungserfahrungen, Erwartungen und Selbstbildern widerspiegelt (Blossfeld et al. 2015).
Typischerweise wirken verschiedene Dimensionen der sozialen Herkunft zusammen (Bargel/Bargel 2010):
- Informationszugänge:
Kinder aus akademischen Familien verfügen oft über mehr Wissen zu Studienwegen, Bewerbungsprozessen, Auslandsaufenthalten oder Finanzierungsmöglichkeiten. Für Erstakademiker*innen ist vieles davon Neuland; sie müssen Strukturen und Begriffe (z.B. „ECTS“, „Modulhandbuch“, „Bewerbungsschluss“) erst kennenlernen. - Finanzielle Spielräume:
Einkommen, Vermögen und Wohnsituation beeinflussen, wie frei Studierende ihre Entscheidungen treffen können. Dies betrifft z.B., ob sie unbezahlte Praktika absolvieren, in andere Städte ziehen, ein Auslandssemester planen oder Vollzeit studieren können. Wer keinen finanziellen Rückhalt hat, ist häufiger auf BAföG, Nebenjobs oder Studienkredite angewiesen und damit zeitlich bzw. finanziell stärker belastet. - Zeitbudget:
Nebenjobs, Care-Verpflichtungen oder lange Pendelzeiten schränken das verfügbare Lern- und Erholungszeitfenster ein. Zeitmangel wirkt sich direkt auf Studienleistungen, aber auch auf Möglichkeiten zur Vernetzung oder Engagement im Hochschulleben aus. - Milieupassung („Cultural
Fit“):
Hochschulen sind oft von unausgesprochenen sozialen Codes geprägt, z.B. wie man in Seminaren spricht, Fragen stellt oder sich „angemessen“ verhält. Wer diese Codes nicht kennt, kann sich zunächst fremd fühlen. Dieses „Hidden Curriculum“ beeinflusst Selbstvertrauen und Zugehörigkeitsgefühl und kann unbewusst Barrieren aufbauen. - Soziales Kapital / Netzwerke: Kontakte zu
Personen, die Wege in Stipendien, Praktika oder wissenschaftliche
Karrieren eröffnen, sind ein entscheidender Vorteil. Studierende ohne
solche Netzwerke müssen sich diese Zugänge erst selbst erarbeiten, oft mit
höherem Aufwand und Unsicherheit.
Soziale Herkunft wirkt somit nicht deterministisch, aber strukturell wirksam: Sie beeinflusst, wer sich ein Studium zutraut, wie Studienentscheidungen getroffen werden, und welche Unterstützung im Verlauf verfügbar ist. Eine diversitätssensible Hochschule erkennt diese Zusammenhänge an und schafft kompensierende Strukturen, etwa durch Mentoring, niedrigschwellige Beratung und finanzielle Brückenangebote.
- Informationszugänge:
-
Soziale Herkunft und Bildungswege an der Hochschule
Der Bildungstrichter zeigt, wie stark Bildungsbeteiligung in Deutschland noch immer von der sozialen Herkunft abhängt (Stifterverband 2021). Ausgangspunkt sind jeweils 100 Kinder aus akademischen und nicht-akademischen Haushalten. Mit jeder Bildungsstufe – vom Studienbeginn bis zur Promotion – verengt sich der Trichter weiter, insbesondere für Kinder aus Familien ohne Hochschulerfahrung.
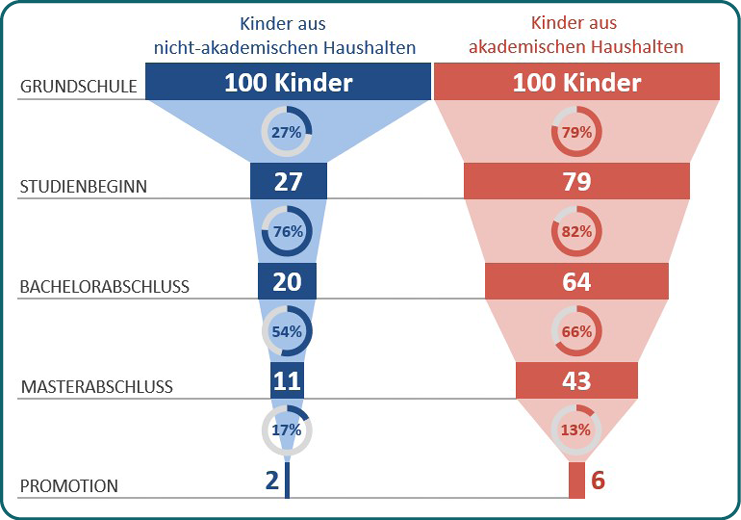
Quelle: https://www.tu-braunschweig.de/koordinierungsstellediversity/fokus2022/konzeptVon 100 Kindern aus nicht-akademischen Haushalten beginnen nur 27 ein Studium, während es bei den akademischen Haushalten 79 sind. Bis zum Bachelorabschluss erreichen noch 20 der Nicht-Akademikerkinder dieses Ziel, beim Masterabschluss 11, und zur Promotion schaffen es lediglich 2.
Zum Vergleich: Von 100 Akademikerkindern promovieren 6.Der Bildungstrichter verdeutlicht damit nicht individuelle Fähigkeiten, sondern strukturelle Unterschiede: Zugang zu Informationen, finanzielle Möglichkeiten, familiäre Unterstützung und kulturelle Erwartungshaltungen beeinflussen Bildungsentscheidungen erheblich (Kratz et al. 2022). Je weiter der Bildungsweg fortschreitet, desto stärker wirkt sich die soziale Herkunft aus – ein Effekt, den man als „kumulative Bildungsungleichheit“ bezeichnet. Bildungschancen verstärken sich also dort, wo bereits günstige Voraussetzungen vorhanden sind, und nehmen dort ab, wo strukturelle Barrieren bestehen.
Für Hochschulen bedeutet das: Chancengerechtigkeit entsteht nicht allein durch formale Zugänge, sondern durch gezielte Förderung, transparente Kommunikation und Unterstützung entlang des gesamten Studienverlaufs, von der Studienorientierung bis zur Promotionsphase.
-

Übung 15 (Modul 4.2)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 15 (Modul 4.2) im Workbook.
-
Soziale Herkunft im Hochschulalltag – Handlungsperspektiven
Soziale Herkunft wirkt nicht nur beim Zugang zur Hochschule, sondern begleitet Studierende auch im Studienverlauf und im alltäglichen Miteinander. Unterschiede in ökonomischen Ressourcen, Vorerfahrungen, Selbstverständnis und Sprache prägen, wie Menschen sich im akademischen Raum bewegen und wie sie wahrgenommen werden. Herkunftssensible Hochschulen nehmen diese Unterschiede bewusst wahr, ohne sie zu stigmatisieren.
Dabei geht es nicht um Sonderförderung für bestimmte Gruppen, sondern um faire Ausgangsbedingungen und die Anerkennung vielfältiger Bildungsbiografien. Eine solche Perspektive erkennt Leistung nicht nur in Noten oder Abschlüssen, sondern auch im Überwinden struktureller Hürden, was auf drei Ebenen möglich ist:
 Strukturelle Ebene – Rahmenbedingungen schaffen
Strukturelle Ebene – Rahmenbedingungen schaffenSoziale Herkunft zeigt sich häufig in den materiellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Studiums. Herkunftssensible Hochschulen schaffen faire und transparente Strukturen, die Teilhabe erleichtern, z.B. durch:
- Abbau finanzieller Barrieren:
Ausbau von Stipendien und Nothilfefonds, professionelle BAföG-Beratung, Vergütung von Pflichtpraktika - lexible Studienorganisation:
Rücksicht auf Erwerbstätigkeit, Pendelzeiten oder Care-Verpflichtungen bei Fristen, Anwesenheitspflichten und Prüfungsterminen
 Kulturelle Ebene – Zugehörigkeit fördern
Kulturelle Ebene – Zugehörigkeit fördernStudieren heißt auch, sich in einer akademischen Kultur zurechtzufinden. Herkunftssensible Hochschulen reflektieren diese Kultur kritisch und gestalten sie offener, z.B. durch:
- Erhöhung der Sichtbarkeit
unterschiedlicher Bildungsbiografien:
Lehrende, Mitarbeitende und Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund werden als Vorbilder sichtbar gemacht. - Förderung offener Kommunikation:
Fragen und Unsicherheiten sollen geäußert werden dürfen, ohne dass sie als „mangelnde Eignung“ interpretiert werden.
 Individuelle Ebene – Haltung und Sensibilität
Individuelle Ebene – Haltung und SensibilitätAuf individueller Ebene geht es um die Bereitschaft, eigene Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata zu hinterfragen und aktiv Barrieren abzubauen, z.B. durch:
- Selbstreflexion:
Welche Vorstellungen habe ich davon, wer „typisch Studentin oder Student“ ist, und wem passe ich dieses Bild unbewusst an? - Empathie und Verständnis:
Unterschiedliche Wege ins Studium anerkennen; Leistung zeigt sich auch darin, unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein - Niedrigschwellige Unterstützung:
Proaktive Ansprache, transparente Erwartungen, Mentoring und regelmäßiges Feedback schaffen Vertrauen und Zugehörigkeit.
Herkunftssensibilität bedeutet letztlich, soziale Herkunft nicht als Defizit, sondern als Teil menschlicher Vielfalt zu begreifen und die Strukturen so zu gestalten, dass Herkunft nicht über Erfolg oder Scheitern entscheidet.
- Abbau finanzieller Barrieren:
-
 Wichtig ist:
Wichtig ist:Herkunftssensibilität beginnt dort, wo wir Routinen hinterfragen und Strukturen so gestalten, dass sie niemanden ausschließen.
-
Unbewusste Vorurteile / Stereotype im universitären Kontext
Auch in Bezug auf soziale Herkunft wirken unbewusste Denkmuster. Viele Menschen verbinden bestimmte Sprache, Kleidung, Auftreten oder Bildungswege automatisch mit Vorstellungen über Leistung, Intelligenz oder Ambition. Solche Stereotype entstehen durch Erfahrungen, Medienbilder und gesellschaftliche Erzählungen darüber, „wer an eine Hochschule gehört“.
-

Übung 16 (Modul 4.2)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 16 (Modul 4.2) im Workbook.
-
Soziale Herkunft x Nationalität und Migrationsgeschichte
Unbewusste Vorannahmen wirken oft nicht isoliert, sondern überlagern sich an mehreren Dimensionen sozialer Differenz. Besonders deutlich wird das, wenn soziale Herkunft und nationale oder kulturelle Zuschreibungen zusammenwirken, also wenn Menschen gleichzeitig über ihren Bildungsweg und über ihre vermeintliche „kulturelle Zugehörigkeit“ eingeordnet werden.
 Ein Beispiel:
Ein Beispiel:
Aylin und Jonas studieren beide im dritten Semester. Aylin ist die erste in ihrer Familie, die studiert. Ihre Eltern sind vor zwanzig Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und führen heute ein kleines Restaurant. Aylin hat vor dem Studium eine Ausbildung gemacht, arbeitet 15 Stunden pro Woche im Nebenjob und pendelt täglich zur Hochschule. Jonas kommt aus einer Akademikerfamilie, lebt in einer Studierenden-WG und wird finanziell von seinen Eltern unterstützt. In einem Seminar diskutieren beide engagiert mit. Nach der Sitzung sagt der Dozent zu Jonas: „Man merkt, dass Sie aus einem gebildeten Elternhaus kommen.“ Zu Aylin sagt er nichts, obwohl sie inhaltlich ebenso fundiert argumentiert hat und den gleichen Punkt sogar zuerst eingebracht hatte. Einige Kommiliton*innen beschreiben Aylin später als „ehrgeizig, aber manchmal unsicher“. Jonas hingegen gilt als „souverän und reflektiert“.Dieses Beispiel zeigt, wie soziale Herkunft und nationale oder kulturelle Zuschreibungen ineinandergreifen:
- Aylin wird aufgrund ihres Namens und familiären
Hintergrunds nicht nur sozial, sondern auch ethnisch oder kulturell anders
verortet. Ihre Kompetenz wird weniger selbstverständlich mit „Bildung“ oder
„Akademikertum“ assoziiert.
- Jonas hingegen profitiert von positiven Vorannahmen
über „akademische Passung“ – eine unsichtbare, aber wirksame Form des Vorteils.
Solche intersektionalen Biases entstehen nicht aus bewusster Diskriminierung, sondern aus unreflektierten gesellschaftlichen Bildern darüber, wer als „typisch akademisch“ gilt.
Ein diversitätssensibler Umgang bedeutet, diese Verflechtungen wahrzunehmen:
- Wer bekommt spontanes Vertrauen, wer muss sich erst „beweisen“?
- Welche Merkmale (Name, Sprache, Auftreten) lösen unbewusst Vorstellungen über Bildung, Intelligenz oder „Kultur“ aus?
- Wie kann im Hochschulkontext aktiv gegengesteuert werden, z. B. durch Feedback, transparente Kriterien und Sensibilisierung für implizite Wahrnehmungsmuster?
- Aylin wird aufgrund ihres Namens und familiären
Hintergrunds nicht nur sozial, sondern auch ethnisch oder kulturell anders
verortet. Ihre Kompetenz wird weniger selbstverständlich mit „Bildung“ oder
„Akademikertum“ assoziiert.
-
„Take away“ und Challenge
- Soziale Herkunft prägt Bildungschancen – von der
Einschulung bis zur Promotion.
- Herkunft ist Teil menschlicher Vielfalt, keine
Defizitkategorie.
- Leistung zeigt sich nicht nur in Noten, sondern
auch im Überwinden struktureller Hürden.
- Unbewusste Vorurteile beeinflussen Wahrnehmung,
Kommunikation und Entscheidungen.
- Herkunftssensible Hochschulen erkennen ungleiche Startbedingungen an, ohne sie zu stigmatisieren.

Challenge Soziale Herkunft:
Beobachten Sie in den kommenden Wochen Ihre eigene Arbeitsumgebung: Wo werden Unterschiede in sozialer Herkunft sichtbar, etwa in Sprache, Verhalten, Erwartungen oder Teilhabechancen? Welche Routinen, Abläufe oder Kommunikationsformen setzen stillschweigend bestimmte Voraussetzungen voraus, zum Beispiel in Bezug auf Zeit, Geld oder Vorwissen?
- Soziale Herkunft prägt Bildungschancen – von der
Einschulung bis zur Promotion.
-
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien - Initiative
arbeiterkind.de: https://arbeiterkind.de/
- MDR-Dokumentation „Das
falsche Versprechen vom Aufstieg: You can win if you want?“: https://www.ardmediathek.de/video/das-falsche-versprechen-vom-aufstieg/das-falsche-versprechen-vom-aufstieg-you-can-win-if-you-want/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC80OTE2NzAtNDcxNzE4
- SWR-Dokumentation
„Unsichtbares Erbe – Über die Chancengerechtigkeit in Deutschland“:
- Nationaler
Bildungsbericht: https://www.bildungsbericht.de/de
- Netzwerk „Chancen“: https://www.netzwerk-chancen.de/
- Initiative
arbeiterkind.de: https://arbeiterkind.de/
-
-
-
Geschlecht ist eine zentrale Dimension von Diversität und zugleich eine, die häufig mit stereotypen Vorstellungen verknüpft ist. Dabei umfasst Geschlecht weit mehr als die Kategorien „männlich“ und „weiblich“. Es beinhaltet sowohl biologische Aspekte als auch soziale, kulturelle und individuelle Identitätsmerkmale sowie gesellschaftliche Zuschreibungen.
Im Hochschulkontext prägt Geschlecht viele Bereiche des universitären Alltags - von Studienwahl und Karrierewegen über Sichtbarkeit bis zu Macht- und Einflussstrukturen. Zugleich wirken gesellschaftliche Rollenbilder und strukturelle Ungleichheiten fort. Diese Lerneinheit lädt dazu ein, Geschlecht als vielschichtiges Konstrukt zu verstehen, eigene Vorannahmen zu reflektieren und Ansätze für eine geschlechtersensible und inklusive Hochschulkultur zu entwickeln. -
Unterschied zwischen biologischem und sozialem Geschlecht (Sex vs. Gender)
Sex und Gender: Warum es wichtig ist, zu unterscheiden
Wenn es um Geschlecht geht, denken viele Menschen zunächst an „männlich“ oder „weiblich“. Doch diese Einteilung greift zu kurz. Für ein differenziertes Verständnis ist die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und dem sozialen bzw. kulturellen Geschlecht (Gender) zentral. Diese Begriffe helfen, besser zu verstehen, wie vielfältig geschlechtliche Identitäten tatsächlich sind und warum die Unterscheidung relevant ist, wenn wir über Gleichstellung, Inklusion und diskriminierungsfreies Handeln sprechen.
Sex
Der englische Begriff sex bezieht sich auf das biologische Geschlecht, das bei Geburt anhand körperlicher Merkmale wie Genitalien, Chromosomen und Hormonen zugewiesen wird. Dieses System unterscheidet meist zwischen „männlich“ und „weiblich“ oder das Feld wird frei gelassen („kein Eintrag“). Seit 2018 besteht außerdem die Möglichkeit im Geburtenregister „divers“ einzutragen. Dies geschieht, wenn das Kind nicht eindeutig männlich oder weiblich, sondern (z.B. genetisch, hormonell oder anatomisch) „intergeschlechtlich“ ist, was bei ca. 0,01% aller Geburten in Deutschland der Fall ist.
Gender
Gender bezeichnet das soziale und kulturelle Geschlecht, also die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Rollenbilder, Erwartungen und Verhaltensweisen, die Menschen aufgrund ihres (vermeintlichen) Geschlechts zugeschrieben werden. Gender ist kein festes Merkmal, sondern ein dynamisches Konstrukt, das sich über Zeit, Raum und individuelle Identität hinweg verändern kann.
Warum ist das relevant im Hochschulkontext?
Die Unterscheidung von Sex und Gender ist entscheidend für ein tieferes Verständnis von geschlechtlicher Vielfalt. Sie ermöglicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit Themen wie Gleichstellung, Diskriminierung oder geschlechterbezogenen Ungleichheiten, etwa in Bezug auf Studienwahl, Karrierechancen, Betreuungspflichten oder Teilhabe. Wer sich dieser Differenz bewusst ist, kann gezielter zu einem inklusiven und diskriminierungssensiblen Hochschulumfeld beitragen.
-
Geschlechtervielfalt und Selbstbezeichnungen
Cis(gender) (lat. cis: diesseits)
Eine Person wird als cisgeschlechtlich (kurz: cis, von lat. cis = „diesseits“) bezeichnet, wenn ihre Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde und gesellschaftlich, als ihr Geschlecht wahrgenommen wird.Inter*/Intergeschlechtlichkeit
Intergeschlechtlichkeit beschreibt eine biologische Vielfalt im Geschlecht, bei der Menschen mit anatomischen, hormonellen oder chromosomalen Merkmalen geboren werden, die nicht eindeutig als männlich oder weiblich klassifiziert werden können. Intergeschlechtliche Menschen erfahren häufig Diskriminierung und Missverständnisse. Deshalb ist es besonders wichtig, im Umgang mit intergeschlechtlichen Personen eine respektvolle Haltung zu wahren und inklusive Sprache zu verwenden.Nicht-binär (lat. bina: doppelt, paarweise) englisch: nonbinary
Das binäre Geschlechterverständnis teilt Menschen in zwei Kategorien: Frau und Mann. Menschen, die sich jedoch nicht vollständig mit einem dieser Geschlechter identifizieren, bezeichnen sich oft als nicht-binär. “Nicht-binär” ist zudem ein Oberbegriff für Identitäten, die sich wandeln (genderfluid) oder solche, bei denen kein Geschlecht empfunden wird (agender).Queer
Queer bezeichnet Menschen aus dem LGBTQIA+-Spektrum. Ursprünglich wurde er abwertend verwendet, mittlerweile jedoch von vielen LGBTQIA+-Personen bewusst übernommen und neu positiv besetzt. Er beschreibt Menschen, die nicht cisgeschlechtlich und/oder hetero sind. Queer zu sein ist eine Lebensweise und eine Selbstbezeichnung.trans*
trans* ist ein Überbegriff für Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei ihrer Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Der Weg, die eigene geschlechtliche Identität zu entdecken und auszuleben, ist dabei individuell und vielfältig. Während manche trans* Menschen ihren Körper durch medizinische Maßnahmen ihrer Geschlechtsidentität anpassen, verzichten andere ganz oder teilweise auf solche Maßnahmen. Oft verwendete Begriffe in diesem Zusammenhang sind „transgender,“ „transident“ und „transgeschlechtlich,“ die jeweils verschiedene Nuancen dieser Identität beschreiben können. -
Gender Gaps
Geschlechter(un)gerechtigkeit zeigt sich auch in Zahlen. In Deutschland bestehen nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, unter anderem (!) in den Bereichen Einkommen, Sorgearbeit, Rente und Datenrepräsentation:
Gender Pay Gap
Der Gender Pay Gap bezeichnet den durchschnittlichen Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. In Deutschland lag der unbereinigte Gender Pay Gap 2024 bei etwa 16 %. Ursachen sind u. a. Berufswahl, Teilzeitquote, Karriereunterbrechungen und strukturelle Benachteiligung (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025a).

Gender Care Gap
Der Gender Care Gap beschreibt den Unterschied in der unbezahlten Sorgearbeit (z. B. Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Haushalt), den Männer und Frauen leisten. Frauen übernehmen hier im Durchschnitt 43,4 % mehr Sorgearbeit, mit Auswirkungen auf ihre Erwerbstätigkeit und finanzielle Absicherung (bmbfsfj 2025).

Gender Pension Gap
Die geschlechtsspezifische Rentenlücke lag 2023 bei 27,1 %. Die Alterseinkünfte von Frauen waren damit durchschnittlich knapp ein Drittel niedriger als die von Männern. Bei Frauen ohne Hinterbliebenenrenten beträgt die geschlechtsspezifische Lücke 39,4 %. Jede fünfte Frau ab 65 Jahren gilt in Deutschland als armutsgefährdet (UN Women 2025).

Gender Data Gap
Der Gender Data Gap beschreibt die systematische Lücke in geschlechtsspezifischen Daten. Frauen werden in Forschung, Medizin oder Technik oft nicht ausreichend berücksichtigt, etwa bei Medikamententests, Crashtest-Dummys oder Arbeitszeitstudien. Das führt zu Benachteiligungen und erhöhten Risiken. Geschlechtersensible Daten sind essenziell für gerechte und wirksame Entscheidungen (Birnbaum 2024).

-
Geschlechtervoreingenommenheit (Gender Bias)
Gender Bias beschreibt die Tendenz, ein Geschlecht bewusst oder unbewusst zu bevorzugen oder anders zu bewerten. Solche Verzerrungen wirken sowohl im Arbeitsalltag als auch in Auswahlprozessen, zum Beispiel bei Bewerbungen.
Studien zeigen, dass geschlechtlich codierte Begriffe Einfluss auf den Bewerbungsprozess haben: Je nachdem, welche Begriffsarten in Stellenausschreibungen genutzt werden, fühlen sich Frauen mehr oder weniger angesprochen und bewerben sich entsprechend/nicht (Gaucher et al. 2011).
- „agentische“ Wörter“ (z.B. durchsetzungsfähig,
leader, competitive, dominar, ambitious) werden stereotyp als männlich
wahrgenommen.
- „kommunalte Wörter“ (z.B. empathisch,
sozial kompetent, understanding, compassionate) werden stereotyp als weiblich
wahrgenommen.
Wie (unbewusst) voreingenommen sind Sie selbst?
Machen Sie den anonymen Test zu Geschlecht und Karriere.
- „agentische“ Wörter“ (z.B. durchsetzungsfähig,
leader, competitive, dominar, ambitious) werden stereotyp als männlich
wahrgenommen.
-
Geschlecht im Hochschulkontext
Geschlecht beeinflusst an Hochschulen zahlreiche Aspekte: von der Wahl des Studienfachs über die Karriereplanung bis hin zur Sichtbarkeit und Teilhabe in akademischen Strukturen. Obwohl Frauen in der Studierendenschaft mittlerweile leicht in der Mehrheit sind, zeigen sich entlang der akademischen Laufbahn deutliche Unterschiede. Besonders in traditionell männlich dominierten Disziplinen wie MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) sind Frauen unterrepräsentiert. Gleichzeitig begegnen sie häufig unbewussten Vorannahmen und Rollenstereotypen, die Studienwahl, den späteren Karriereverlauf, wie Promotion und Berufung beeinflussen können.
Studienwahl
Studien zeigen, dass bestimmte Studiengänge traditionell als „männlich“ oder „weiblich“ wahrgenommen werden. In MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind Frauen unterrepräsentiert, was zu einer geschlechtsspezifischen Berufserwartung führt. Das liegt nicht nur an gesellschaftlichen Erwartungen, sondern auch an der mangelnden Sichtbarkeit von Frauen in diesen Bereichen und der sozialen Prägung, dass technische Berufe eher für Männer bestimmt seien, wohingegen Frauen in sozialwissenschaftlichen Fächergruppen (bspw. Erziehungswissenschaften, Sozialwesen, Psychologie) deutlich überrepräsentiert sind. (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025b).
Am stärksten besetzte Studienfächer
(Studierende im Wintersemester 2022/2023)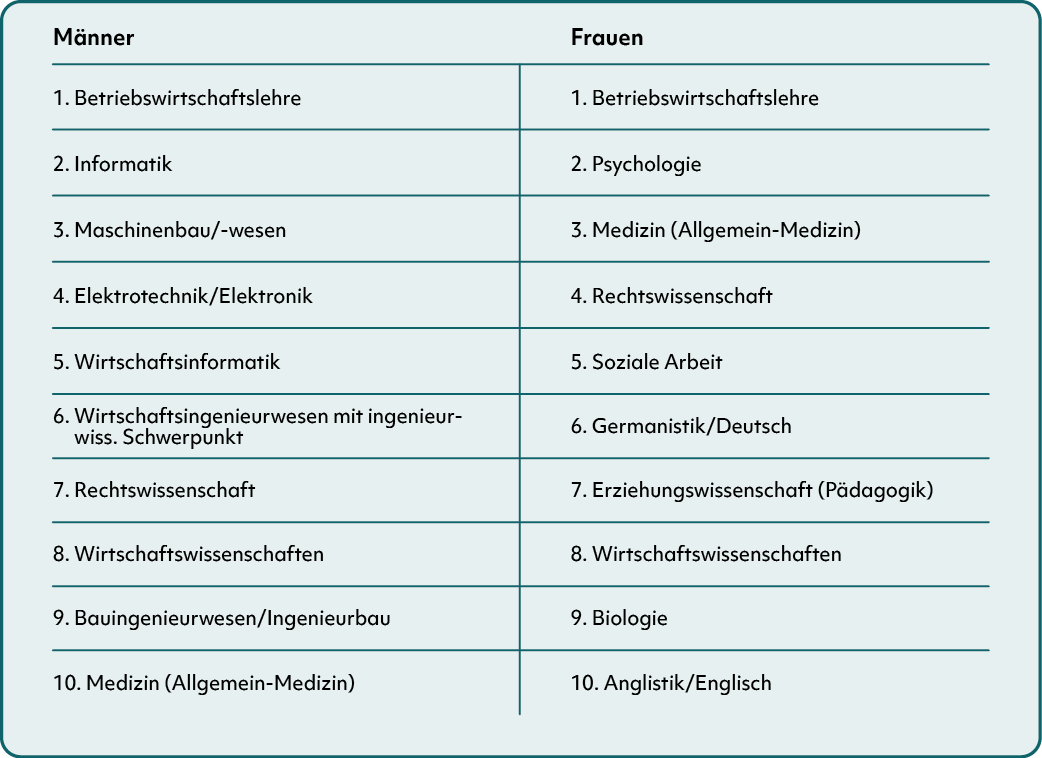
Quelle: Eigene Darstellung nach Destatis, Studierende an Hochschulen; Wintersemester 2022/23Karriereverlauf
Der Karriereverlauf von Frauen in akademischen Kontexten wird oft durch „gläserne Decken“ behindert. Diese unsichtbaren Barrieren verhindern die berufliche Weiterentwicklung von Frauen, obwohl sie qualifiziert sind. Im Gegensatz dazu erfahren männliche Kollegen oft eine größere Unterstützung und haben Zugang zu Netzwerken, die ihre Karriere fördern. In den gezeigten Grafiken wird deutlich, dass Frauen häufiger höhere Schulabschlüsse erreichen und auch öfter ein Studium beginnen als Männer. Ab dem Masterabschluss jedoch kehrt sich dieses Bild um: Männer erreichen ab diesem Punkt häufiger einen höheren akademischen Grad.
Schulabschlüsse 2023 nach Geschlecht der Absolvierenden
(Anteil je Schulabschluss an allgemeinbildenden Schulen, in %)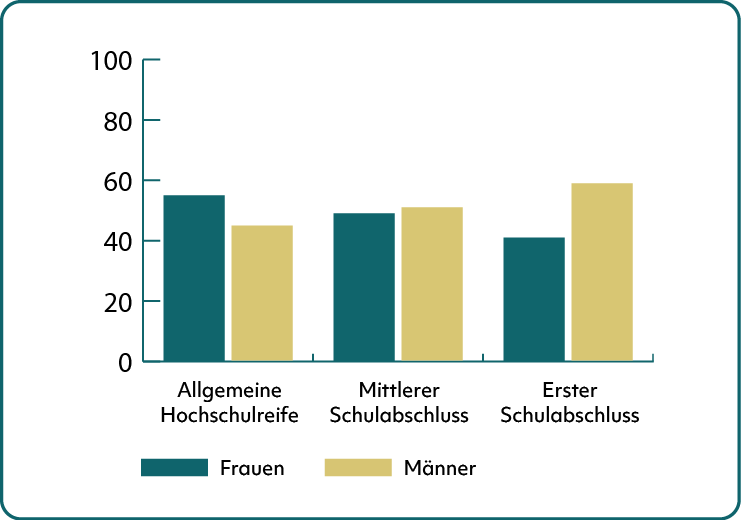
Quelle: Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt (Destatis) 2025c.
Prüfungsjahr 2023: Frauenanteil im Hochschulkontext
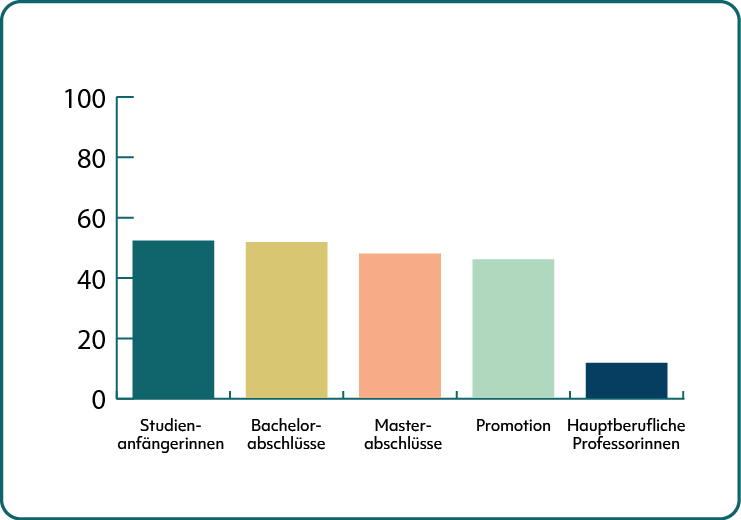
Quellen: Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024 & CHE Hochschuldaten 2025
→ Diese Zahlen zeigen, dass trotz hoher Bildungsbeteiligung von Frauen strukturelle Unterschiede in Leitungspositionen bestehen. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der akademischen Welt bleibt somit eine wichtige Herausforderung. Trotz gesetzlicher Regelungen und Initiativen wie Gleichstellungsbeauftragten an Universitäten gibt es weiterhin Hürden, die es Frauen erschweren, Führungspositionen zu erreichen.
-

Übung 17 (Modul 4.3)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 17 (Modul 4.3) im Workbook.
-
Geschlecht x Nationalität und Migrationsgeschichte
Wie die anderen Diversitätsdimensionen wirkt auch „Geschlecht“ intersektional. Das Geschlecht allein erklärt daher nur einen Teil der Erfahrungen, die Menschen in Bildung, Beruf und Alltag machen. Gerade im Hochschulkontext wird deutlich, wie komplex diese Überschneidungen sein können: Studierende und Mitarbeitende bringen unterschiedliche kulturelle Prägungen, Erwartungen und Erfahrungen mit, die das Zusammenspiel von Geschlecht und Nationalität & Migrationsgeschichte beeinflussen. Wie begegnet uns die Dimension „Geschlecht“ beispielsweise im Umgang mit internationalen Studierenden?
Verschiedene Erwartungen und Vorurteile im internationalen Kontext
Internationale Studierende bringen gegebenenfalls unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechterrollen mit. In einigen Kulturen sind traditionelle Rollenbilder stärker ausgeprägt als in Deutschland, wo Gleichstellung zwischen den Geschlechtern gesetzlich und institutionell gefördert wird. Dies kann zu Missverständnissen führen, z. B. wenn Studierende auf weibliche Professorinnen in Führungspositionen treffen oder Männer, die von einem Hochschulsystem höhere Eigeninitiative erwarten. Solche Situationen erfordern Sensibilität und Reflexion von Hochschulmitarbeitenden.
Auch Mitarbeitende können unbewusste Annahmen über das Verhalten von Studierenden aufgrund von Geschlecht und zugeschriebener Migrationsgeschichte treffen. Beispielsweise werden männlichen und weiblichen Studierenden aus bestimmten Kulturen unterschiedliche Eigenschaften zugeschrieben, die in der Lehre, Beratung oder Zusammenarbeit zu ungleichen Erwartungen führen können. Auch hier können selbstverständlich Konflikte aufgrund unterschiedlicher Erwartungshaltungen auftreten, wenn Studierende das Gefühl haben, dass sie aufgrund ihrer Kultur oder ihres Geschlechts benachteiligt werden.Wahrnehmung von Geschlechterdiskriminierung
Internationale Studierende erleben Geschlechterdiskriminierung abhängig ihrer Nationalität, Migrationsgeschichte oder ihrem Zugehörigkeitsgefühl höchst unterschiedlich. Für Studierende aus Ländern, in denen geschlechtsspezifische Diskriminierung oder Ungleichheiten weit verbreitet sind, kann das Bewusstsein über Gleichstellung im deutschen Hochschulsystem befremdlich oder sogar widersprüchlich wirken. Umgekehrt erleben internationale Studierende aus weit fortgeschritteneren Ländern Gleichstellung in Deutschland als rückschrittig, beispielsweise in Bezug auf die Kinderbetreuung während Veranstaltungen an Universitäten.
Gendergerechtigkeit als Herausforderung in der Zusammenarbeit
Hochschulmitarbeitende müssen sich dessen bewusst sein, dass Studierende unterschiedliche Werte und Erfahrungen im Hinblick auf Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit mitbringen. Ein Team aus verschiedenen Nationalitäten und kulturellen Hintergründen kann unterschiedlich auf Diversity-Initiativen reagieren. Deshalb ist es wichtig, die Förderung zur Gendergerechtigkeit transparent zu kommunizieren und dabei die Diversität der Studierenden zu respektieren.
→ Gibt es an der Hochschule bereits Anlaufstellen oder Angebote für Studierende und Mitarbeitende zu dieser Thematik, wie Empowerment-Workshops, Gesprächsräume, Career Mentoring, Beratungsstellen oder Mediation etc.? Stellen Sie sicher, dass Sie die Anlaufstellen oder Programme kennen und darauf verweisen können, wenn es zu Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag kommt.
-
„Take away“ und Challenge
- Geschlecht ist vielfältig und umfasst biologische,
soziale, kulturelle und individuelle Aspekte – mehr als nur „männlich“ und
„weiblich“.
- Sex ≠ Gender:
→ Sex = biologisches Geschlecht
→ Gender = soziale/kulturelle Geschlechtsidentität.
- Es bestehen Gender Gaps in Deutschland,
z. B. Pay Gap (18 %), Care Gap (43 %) oder Pension Gap
(27 %)
- trans*,
nicht-binär, inter, cis* - Vielfalt geschlechtlicher Identitäten fordert
inklusive Sprache und Sichtbarkeit.
-
Im Hochschulkontext
beeinflusst das Geschlecht Studienwahl, Karrierechancen, Sichtbarkeit und
Teilhabe.

Challenge Geschlecht:
Denken Sie daran, dass die Dimension „Geschlecht“ keine starre Kategorie ist, sondern ein Spektrum, das durch persönliche, kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse geprägt wird. Reflektieren Sie darüber, wie Sie in Ihrem Berufsalltag geschlechtliche Stereotype aufdecken und hinterfragen können.
- Geschlecht ist vielfältig und umfasst biologische,
soziale, kulturelle und individuelle Aspekte – mehr als nur „männlich“ und
„weiblich“.
-
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien - Zentrums für Geschlechterstudien/ Gender
Studies der Universität Paderborn: Podcast „Zeit für Gender“.
- Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und
Gleichstellung der Uni Graz: Podcast “Gender & mehr – leicht gesagt“.
- Deutschlandfunk
2024: Gleichberechtigung – Die absurden Fakten des Gender Gaps.
-
https://www.ardaudiothek.de/episode/kulturfragen/gleichberechtigung-die-absurden-fakten-des-gender-gaps/deutschlandfunk/13365331/, zuletzt geprüft am 12.11.2025.
- WILLKOMMEN IM CLUB - Der queere Podcast von Puls 2022: Von wegen nur Frau und Mann - Geschlecht in anderen Kulturen. Staffel 8, Episode 86. https://www.br.de/mediathek/podcast/willkommen-im-club-der-queere-podcast-von-puls/von-wegen-nur-frau-und-mann-geschlecht-in-anderen-kulturen/1905232, zuletzt geprüft am 12.11.2025.
- Zentrums für Geschlechterstudien/ Gender
Studies der Universität Paderborn: Podcast „Zeit für Gender“.
-
-
-
In diesem Modul geht es um körperliche und geistige Fähigkeiten – und darum, welche Rahmenbindungen für echte Teilhabe geschaffen werden müssen. Denn Behinderung ist nicht nur eine individuelle Eigenschaft, sondern oft das Ergebnis gesellschaftlicher barrierebedingter, digitaler oder kommunikativer Art. Ziel dieses Modul ist es, zentrale Begriffe zu klären, Einblicke in die Lebensrealität von Menschen mit Behinderung zu ermöglichen und zur Reflexion über den eigenen Umgang mit dem Thema Behinderung im universitären Kontext anzuregen.
-
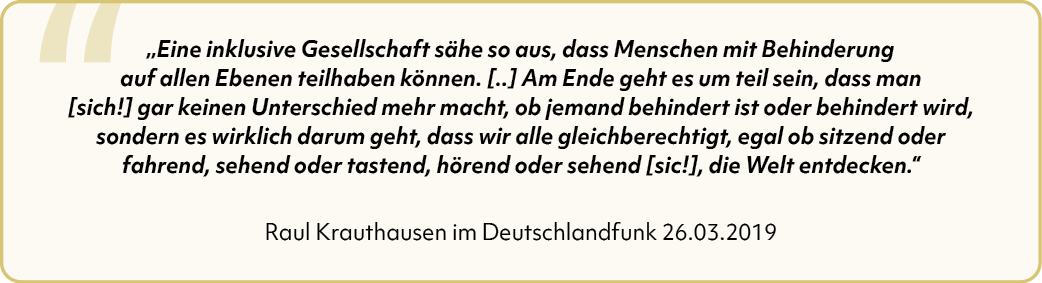
-
Wie sage ich es richtig?
Sprache ist ein entscheidendes Instrument für Inklusion und Teilhabe und so ist es wichtig sich damit zu beschäftigen, wie über und mit Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Denn: mitgemeint ist nicht gleich mitgedacht. Zunächst einmal braucht es keine Scheu vor dem Wort „Behinderung“, es ist eine neutrale Bezeichnung, die häufig die bevorzugte Selbstbezeichnung von Menschen mit Behinderung ist. Natürlich ist jeder Mensch individuell und so sollten persönliche Präferenzen erfragt und respektiert werden. Es wird gemäß dem Identity-First-Ansatz von „Menschen mit Behinderung“ (statt „behinderten Menschen“ oder „dem*der Behinderten“) gesprochen, um den Fokus auf das Individuum zu lenken und um zu verdeutlichen, dass die Behinderung nur ein Teil der Identität ausmacht (MyAbility o.J.; Schach 2023: 95f.).
Das Projekt Leidmedien besteht aus einem Team Medienschaffender mit und ohne Behinderung, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Redaktionen zu inklusiver Sprache in diesem Bereich zu beraten. Auf ihrer Webseite finden sich Negativbeispiele und Alternativvorschläge für Formulierungen auf Augenhöhe. Hier ein Auszug (Leidmedien 2017):
 „Tapfer und mutig meistern sie ihr Leben"
„Tapfer und mutig meistern sie ihr Leben" Alternative: Für viele
Menschen ist die Behinderung Teil ihres Lebens, den sie akzeptieren und als bloße Frage der Organisation
verstehen – ganz ohne Tapferkeit.
Alternative: Für viele
Menschen ist die Behinderung Teil ihres Lebens, den sie akzeptieren und als bloße Frage der Organisation
verstehen – ganz ohne Tapferkeit. „Trotz der Behinderung“
„Trotz der Behinderung“ Alternative: Dass behinderte Menschen Dinge nicht trotz
oder wegen, sondern mit ihrer Behinderung tun, sollte
sprachlich selbstverständlich werden.
Alternative: Dass behinderte Menschen Dinge nicht trotz
oder wegen, sondern mit ihrer Behinderung tun, sollte
sprachlich selbstverständlich werden. „Jemand leidet an etwas“
„Jemand leidet an etwas“ Alternative: Dass ihnen ihre Behinderung dauerndes,
konstantes Leiden bringen würde, bestreiten die meisten behinderten Menschen. „Eine
Person hat XY oder lebt mit XY“ – solche Formulierungen kommen der Realität
deutlich näher.
Alternative: Dass ihnen ihre Behinderung dauerndes,
konstantes Leiden bringen würde, bestreiten die meisten behinderten Menschen. „Eine
Person hat XY oder lebt mit XY“ – solche Formulierungen kommen der Realität
deutlich näher. „Jemand ist an den Rollstuhl gefesselt“
„Jemand ist an den Rollstuhl gefesselt“ Alternative: Statt gefesselt zu sein „nutzen“, „benutzen“
oder „brauchen“ Rollstuhlfahrende einen Rollstuhl, „sitzen“ in ihm, sind „auf
ihn angewiesen“ oder sind einfach mit ihm „unterwegs“. Falls Sie doch mal einen
Menschen treffen sollten, der an einen Rollstuhl gefesselt ist – binden Sie ihn
sofort los!
Alternative: Statt gefesselt zu sein „nutzen“, „benutzen“
oder „brauchen“ Rollstuhlfahrende einen Rollstuhl, „sitzen“ in ihm, sind „auf
ihn angewiesen“ oder sind einfach mit ihm „unterwegs“. Falls Sie doch mal einen
Menschen treffen sollten, der an einen Rollstuhl gefesselt ist – binden Sie ihn
sofort los! -
„Behindert ist man nicht, behindert wird man."
Behinderung entsteht durch Barrieren und Menschen sind nicht behindert, sondern werden behindert. Das beschreibt die Journalistin Christiane Link bei ihrem Vortrag über ihr eigenes Leben als Rollstuhlfahrerin. (Den 5-minütigen Vortrag finden Sie hier.)
Was bedeutet das konkret? Behinderung entsteht durch Barrieren im Kopf von Menschen, aber auch durch ausschließende Strukturen:
- Wenn das Theater keine Rampe hat.
- Wenn am Bahnhof der Aufzug kaputt ist.
- Wenn im Museum keine Führungen in Gebärdensprache verfügbar sind.
- Wenn Internetseiten nicht kompatibel mit Screenreadern gestaltet werden.
- Wenn es bei Veranstaltungen keine ruhigen Rückzugsräume gibt.
- Wenn wichtige
Informationen für alle Bürger*innen mit komplizierten und schwer verständlichen
Worten beschrieben werden.
Die Verantwortung liegt nicht bei den Betroffenen, sondern bei uns allen. Strukturen, Kommunikation, Design etc. entscheiden darüber, wer teilhaben kann und wer nicht.
-
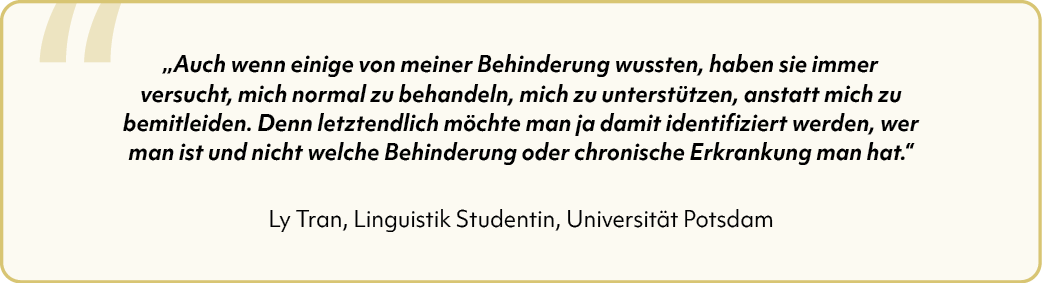
-

Übung 18 (Modul 4.4)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 18 (Modul 4.4) im Workbook.
-
Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland
Der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung hat sich in Deutschland über die Jahrzehnte stark gewandelt - von Ausgrenzung hin zu einem wachsenden Verständnis von Teilhabe, Rechten und Selbstbestimmung. Bis weit ins 20. Jahrhundert dominierten medizinische und fürsorgerische Perspektiven: Menschen mit Behinderung galten als „pflegebedürftig“, „defizitär“ oder „nicht leistungsfähig“. Besonders die Zeit des Nationalsozialismus markiert ein grausames Kapitel. Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen wurden systematisch entrechtet, zwangssterilisiert und im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Programme ermordet. Diese Verbrechen prägen bis heute die Erinnerungskultur und unterstreichen die fundamentale Bedeutung von Menschenrechten und Schutz vor Diskriminierung (Fuchs 2023).
Nach 1945 blieb das Verständnis von Behinderung lange von einem paternalistischen Fürsorgeansatz geprägt, bei dem die Behinderung als das ‚Andere‘ verstanden wurde und Nicht-Behinderung als Normalität galt (Fuchs 2023). Menschen mit Behinderung wurden oft in speziellen Einrichtungen, Werkstätten oder Heimen, getrennt von der Mehrheitsgesellschaft, untergebracht. Erst ab den 1960er und 70er Jahren formierte sich eine selbstbewusste Behindertenrechtsbewegung, die lautstark forderte: „Nothing about us without us“ (dt. „Nichts über uns ohne uns“). Aktivistinnen machten auf fehlende Barrierefreiheit, soziale Ausgrenzung und Ungleichbehandlung aufmerksam. Sie kritisierten die strukturelle Abhängigkeit von Wohlfahrtsorganisationen und riefen dazu auf, Menschen mit Behinderung als vollwertige Bürger*innen mit eigenen Rechten und Entscheidungsmacht anzuerkennen.
Diese Bewegung ebnete den Weg für zentrale politische Veränderungen: die Abschaffung diskriminierender Gesetze, erste Ansprüche auf Barrierefreiheit, die Einführung von Integrationshilfen und die Verankerung der Gleichstellung im Grundgesetz im Jahr 1994. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 wurde schließlich ein Paradigmenwechsel festgeschrieben: weg vom Fürsorgemodell hin zu einem Menschenrechtsansatz, der Selbstbestimmung, Inklusion und diskriminierungsfreie Teilhabe in allen Bereichen des Lebens fordert (Eichstedt/ Wulff 2023).
Doch trotz dieser Fortschritte zeigen aktuelle Berichte, dass die Umsetzung noch lange nicht abgeschlossen ist. Inklusion ist kein Zustand, sondern ein fortlaufender gesellschaftlicher Prozess.
Wie sieht die Realität heute aus?
Fast 10% der Menschen in Deutschland leben mit einer Schwerbehinderung. Trotzdem sind Barrieren überall spürbar. Menschen mit Behinderung erleben weiterhin Ausgrenzung im Alltag, weil sie nicht mitgedacht werden. Echte Inklusion bedeutet nicht, dass „besonders“ Rücksicht genommen wird, sondern dass Teilhabe von Anfang an mitgedacht wird und öffentliche Räume, Bildungseinrichtungen, digitale Angebote etc. für alle Menschen zugänglich sind. Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland wird besonders in Hinblick auf das zu langsame Tempo bei dem Abbau von Sonderstrukturen und Diskriminierung deutlich Kritik geübt (Aktion Mensch 2024). Inklusive Bildung, Arbeitsplätze, Freizeitangebote sind kein Luxus, sondern die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft.
-
Körperliche und geistige Fähigkeiten x Nationalität & Migrationsgeschichte
Ein Auslandssemester ist für viele Studierende eine aufregende und bereichernde Zeit – es bietet eine Vielzahl an neuen Kulturen, neuen Menschen und neuen Erfahrungen. Für Studierende mit Behinderung bringt ein solcher Schritt jedoch oft zusätzliche Herausforderungen mit sich. Umso wertvoller sind Erfahrungsberichte von denen, die diesen Weg bereits gegangen sind. In diesem Interview spricht Leon [Name geändert], ein Student mit Behinderung der Universität Würzburg, über sein Auslandssemester in Utrecht, Niederlande. Offen und reflektiert teilt er seine Erlebnisse, Herausforderungen und Eindrücke aus dieser Zeit.

Welche besonderen Herausforderungen hattest du bei der Vorbereitung deines Auslandssemesters im Hinblick auf deine Behinderung?
Ich muss sagen, ich habe im Vorfeld oft etwas dazu gelesen – es gab einen ganz offenen Disclaimer, dass man mit chronischen Erkrankungen unterstützt wird. Man bekam sowohl an der Heimatuniversität als auch an der Gasthochschule entsprechende Kontakte. Das war also relativ gut organisiert. Ich muss auch sagen, die Ansprechpersonen, die ich sowohl in Utrecht als auch in Würzburg erlebt habe, waren total kompetent und sehr nett.
Trotzdem ist es natürlich schwierig, weil es etwas sehr Individuelles ist. Man muss seinen eigenen Weg finden. Ich musste zum Beispiel schauen, dass mein Nachteilsausgleich auch in Utrecht angerechnet werden konnte – das wurde zum Glück einigermaßen übernommen. Gleichzeitig muss man natürlich auch im Alltag klarkommen, und da ist man häufig auf sich allein gestellt. Aber das ist jetzt nichts, was speziell mit der Uni zu tun hätte oder was ich negativ bewerten würde – es ist einfach eine allgemeine Lebenssituation, in der man erst einmal schauen muss, wie man ankommt und zurechtkommt.
Was ich tatsächlich herausfordernder fand – was auch irgendwie logisch ist, aber schwer planbar – war weniger die Uni selbst als der Alltag drumherum. Man macht ein Erasmussemester ja wegen des Studiums und der Universität im Gastland, aber wirklich herausfordernd ist oft das Leben außerhalb der Uni. Ich habe zum Beispiel sehr wenig Informationen zur Unterkunft bekommen, zu Ansprechpartnern vor Ort oder zu praktischen Dingen wie Parkmöglichkeiten. Die generelle Barrierefreiheit – also die Accessibility, die nicht direkt mit der Uni zu tun hat, aber eng damit zusammenhängt – war viel schwerer einschätzbar.
Da kommt es einfach stark darauf an, wie das Land ist, wie die Stadt aufgebaut ist, wie das Gebäude aussieht und wie die Menschen vor Ort sind. Und genau das ist oft wichtiger als alles andere – aber leider auch viel schwieriger vorher abzuschätzen.
Wie war deine Erfahrung, mit Behinderung im Ausland zu studieren?
Insgesamt war es eine positive Erfahrung. Die Niederlande sind ein privilegiertes und offenes Land, das Menschen mit Beeinträchtigung vergleichsweise gut einbindet – zum Teil sogar besser als in Deutschland. Ich habe guten Support bekommen und mich größtenteils gut integriert gefühlt. Die wenigen negativen Erfahrungen lagen eher an allgemeinen Lebensumständen und nicht an der Uni oder dem Land selbst.
Gab es interkulturelle Herausforderungen?
Kaum. Die kulturellen Unterschiede zur Heimat waren zwar spürbar, aber durch die große Offenheit der niederländischen Gesellschaft und die hohe Englischkompetenz war es einfach, sich zu verständigen. Ich habe mich im interkulturellen Kontakt sogar fast verbundener gefühlt als in Deutschland.
Wo wünschst du dir mehr Unterstützung von der Universität?
Ich wünsche mir nicht unbedingt mehr Unterstützung, denn insgesamt hatte ich das Gefühl, dass gut auf mich geachtet wurde. Gleichzeitig hätte ich jederzeit noch mehr Hilfe in Anspruch nehmen können, wenn es nötig gewesen wäre. Zum Beispiel habe ich frühzeitig gemerkt, dass ich die Deadlines für meine beiden Paper nicht einhalten kann – der Arbeitsrhythmus hier ist ziemlich straff. Anders als in Deutschland gibt es in Utrecht zwei Semesterabschnitte mit kürzeren Kursen, und die Deadlines lagen oft nur ein bis zwei Wochen nach Kursende. Das war für mich aufgrund der vielen Bildschirmarbeit und meiner Beeinträchtigung dahingehend kaum zu schaffen. Ich habe dann beide Abgabefristen offiziell verlängern lassen. Eine nochmalige Verlängerung wäre möglich gewesen, aber das war mir dann unangenehm – auch wenn es prinzipiell kein Problem gewesen wäre.
Im Unterricht selbst war die Unterstützung eher begrenzt. Es hieß sinngemäß: „Wenn du nicht sitzen kannst, dann steh eben auf und geh." Das war nicht böse gemeint, aber es gab keine weiteren Optionen. Die Räume waren oft überfüllt, und ich habe mich nicht wohlgefühlt, im laufenden Seminar einfach im Raum umherzugehen. Deshalb bin ich in solchen Situationen oft kurz rausgegangen oder sogar ganz nach Hause – einfach, um mir selbst eine Pause zu ermöglichen.

Leons Erfahrungen verdeutlichen, wie wichtig eine gute Vorbereitung und klare Kommunikation sind, um Studierende mit Behinderung während eines Auslandssemesters zu unterstützen. Besonders hervorzuheben ist die Notwendigkeit, sowohl akademische als auch alltägliche Barrieren individuell zu berücksichtigen.
-

Übung 19 (Modul 4.4)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 19 (Modul 4.4) im Workbook.
-
„Take away“ und Challenge
Behinderung ist kein individuelles Defizit, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher Barrieren
„Wir sind nicht behindert, wir werden behindert“. Das zu erkennen, ist kein Vorwurf von Aktivist*innen, sondern eine Einladung zum Umdenken und zur Neugestaltung.
Worte besitzen große Macht. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten wichtig und so auch der offene Dialog darüber.
Barrierefreiheit bezieht sich nicht nur auf Rampen, sondern auch auf Webseiten, Abläufe und die gesellschaftliche Haltung zum Thema.

Challenge Körperliche & geistige Fähigkeiten:
Reflexionsfragen zum Mitnehmen:
Sind Informationen, Räume, Formulare oder digitale Angebote in meinem Bereich für alle zugänglich - unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Voraussetzungen?
Wo erkenne ich (unsichtbare) Barrieren in meinem Arbeitskontext (z. B. komplizierte Sprache, fehlende Untertitel, starre Abläufe)?
Welche Veränderungen zu mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung könnte ich in meinem Arbeitsbereich anregen?
-
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien Behindernisse (o.J.). #behindernisse. https://be-hindernisse.org, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Podcastreihe „Wir sind UP“ der Universität Potsdam. https://www.uni-potsdam.de/de/inklusive-hochschule/podcasts-wir-sind-up, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
-
-
-
Sexuelle Orientierung ist Teil menschlicher Identität und zugleich ein Bereich, in dem gesellschaftliche Normen, Unsicherheiten und Stereotype immer noch spürbar sind. Dieses Modul eröffnet einen Raum, um die Vielfalt sexueller Orientierungen kennenzulernen und die Perspektiven queerer Menschen sichtbar zu machen. Im Mittelpunkt stehen zentrale Begriffe, Alltagserfahrungen und historische Entwicklungen.
-

In dieses Modul starten wir mit einer kleinen Geschichte. Es ist ein sonniger Dienstagmorgen in Jena. Lena sitzt mit einem Kaffee in der Hand im Seminarraum am Ernst-Abbe-Platz. Die Dozentin kommt etwas zu spät, verbindet ihren Laptop mit dem Beamer und bittet die Gruppe dabei, Karten mit Begriffen an eine Pinnwand zu heften, die mit Sexueller Orientierung zu tun haben. Lena lehnt sich zurück und denkt: Puh, das wird bestimmt kompliziert. Aber eigentlich ganz spannend.
Zehn Minuten vergehen und die Pinnwand hat sich recht schnell gefüllt. „Sexuelle Orientierung“, liest Lena laut vor. „Das heißt… zu wem sich jemand hingezogen fühlt, oder?“ Die Dozentin nickt. „Genau. Ob jemand sich romantisch oder sexuell zu Männern, Frauen, mehreren oder keinem Geschlecht hingezogen fühlt.“ Lena sieht eine weitere Karte, auf der Sexuelle Identität geschrieben steht. „Das geht dann schon etwas tiefer“, erklärt Lenas Kommilitonin Antje. „Das ist Teil meines Selbstbilds – also, wie ich mich selbst sehe. Nicht nur, mit wem ich schlafe oder wen ich liebe.“ Dann tippt Antje auf eine bunte Karte mit Sternchen: LSBTIQ*. „Das steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans*, Inter* und Queer – und das Sternchen zeigt: Es gibt noch viel mehr Identitäten, die dazugehören und mitgedacht werden.“
Lena schaut auf die nächste Karte, die an der Pinnwand hängt: Queer. „Ein Sammelbegriff“, sagt Lenas Mitbewohner Tom. „Für Menschen, die nicht heterosexuell oder nicht binär sind. Manche sagen einfach: ‚Ich bin queer‘, weil es Raum für Individualität lässt.“ Daneben hängt der Klassiker: Heterosexuell. „Ist das der Fall, wenn man sich zum jeweils anderen Geschlecht hingezogen fühlt?“, fragt Lena. „Korrekt!“, sagt Antje. „Und im Gegensatz dazu stehen Begriffe wie homosexuell, bisexuell, pansexuell, polysexuell oder asexuell – jede dieser Orientierungen beschreibt eine andere Form von Anziehung oder eben auch deren Abwesenheit.“
Lena liest auf den Karten an der Pinnwand:
- Homosexuell – Liebe zum eigenen Geschlecht
- Bisexuell – Liebe zu zwei Geschlechtern
- Pansexuell – Liebe unabhängig vom Geschlecht
- Polysexuell – Liebe zu vielen, aber nicht notwendigerweise zu allen Geschlechtern
- Asexuell – wenig oder keine
sexuelle Anziehung
‚Ganz schön vielfältig‘, denkt Lena. Die Dozentin erklärt: „Das hier sind nur einige Beispiele. Es gibt noch viele weitere Formen, wie Menschen fühlen, lieben und leben.“
Dann wird es kurz still. Tom nimmt die letzte Karte von der Pinnwand und legt sie auf den Tisch: Coming-out. „Das kann innerlich oder äußerlich passieren“, erklärt die Dozentin. „Zuerst erkennt man vielleicht für sich selbst: Ich bin queer. Das ist das innere Coming-out. Und irgendwann entscheidet man, ob und wann man anderen davon erzählt – das äußere Coming-out.“ „Und wenn jemand das ohne Zustimmung weitererzählt?“ fragt Lena. „Dann ist das ein Outing“, sagt die Dozentin ernst. „Und das ist nie okay. Es verletzt die Selbstbestimmung einer Person.“
Zum Abschluss zeigt die Dozentin ein Foto einer Familie mit zwei Müttern und einem kleinen Kind.
„Das ist eine Regenbogenfamilie“, sagt sie. „Familien, in denen mindestens ein Elternteil queer ist. Regenbogenfamilien zeigen, dass Liebe und Fürsorge viele Formen haben.“ Lena lächelt. ‚Ich glaube‘, denkt sie, ‚diese Begriffe sind gar nicht nur Theorie. Sie sind Geschichten von Menschen, die einfach sie selbst sein wollen – in all ihrer Vielfalt.‘
 Wichtig:
Wichtig:Diese Übersicht über Begriffe aus dem Themenfeld ‚sexuelle Orientierung‘ ist nicht vollständig. Es gibt weit mehr sexuelle und geschlechtliche Identitäten als hier genannt. Sprache und Begriffe entwickeln sich ständig weiter und sind Werkzeuge, keine Schubladen. Sie helfen dabei, respektvoll über Identität, Orientierung und Zugehörigkeit zu sprechen und zugleich offenzubleiben für die Entwicklungen, die Sprache und Gesellschaft weiter verändern (Jäkh 2024).
-
Queere Rechte in Deutschland
Queeres Leben ist heute in Deutschland in vielen Bereichen sichtbar und rechtlich anerkannt, wird jedoch nicht überall als selbstverständlich betrachtet. Die Geschichte sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Deutschland ist eine Geschichte des langen Kampfes um Sichtbarkeit, Rechte und Würde. Von Kriminalisierung und Verfolgung über mutigen Aktivismus bis hin zu rechtlicher Gleichstellung: Jede Etappe steht für Menschen, die Widerstand geleistet, Solidarität gelebt und gesellschaftlichen Wandel angestoßen haben.
Die folgende Bilderreihe zeigt einige zentrale Meilensteine der queeren Emanzipation in Deutschland – von der Einführung des §175 im Jahr 1871 bis zu jüngsten Fortschritten wie der „Ehe für alle“ und dem Verbot sogenannter Konversionsbehandlungen.
Sie lädt dazu ein, genauer hinzuschauen:- Welche Veränderungen waren besonders bedeutsam?
- Welche Kämpfe dauern bis heute an?
- Und was bedeutet gesellschaftliche Anerkennung jenseits von Gesetzen?
-
Verbündetet Sein/ Allyship
Trotz der Erfolge, die queere Aktivist*innen in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, erfahren nicht-heterosexuelle Menschen weiterhin Diskriminierung, häufig in Form struktureller Benachteiligung:
- Grundgesetz noch nicht
inklusiv
Art. 3 Abs. 3 GG schützt zwar vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Sprache, Religion und Behinderung. Ein explizites Verbot der Benachteiligung sexueller Minderheiten fehlt jedoch. - Ungleichheit bei Adoptionen
Homosexuelle Paare sind rechtlich nicht vollständig mit heterosexuellen Paaren gleichgestellt, insbesondere im Adoptionsrecht. - Fehlende Gleichstellung in
gesellschaftlichen Bereichen
In Institutionen wie der Kirche, der Bundeswehr oder im Profisport ist die Gleichbehandlung von queeren Menschen noch nicht flächendeckend umgesetzt.
Deshalb ist es umso wichtiger, ein Ally – also eine verbündete Person – zu sein. Ein Ally setzt sich aktiv für die Rechte und die Gleichbehandlung queerer Menschen ein, auch wenn man selbst nicht zur LGBTQIA+-Community gehört. Das bedeutet, Diskriminierung nicht zu ignorieren, sondern offen anzusprechen, Betroffene zu unterstützen, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich für gesellschaftliche Veränderungen starkzumachen. Nur gemeinsam kann eine gerechte und vielfältige Gesellschaft entstehen, in der alle Menschen – unabhängig von ihrer sexuellen Identität – gleichbehandelt und respektiert werden.
- Grundgesetz noch nicht
inklusiv
-
Sexuelle Orientierung im Hochschulalltag – Handlungsperspektiven
Diskriminierung, Stereotype und Vorurteile gegenüber Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung wirken oft subtil, können aber im universitären Alltag spürbare Auswirkungen haben, z.B. in Lehrsituationen, im Umgang miteinander oder bei der Vergabe von Chancen. Umso wichtiger ist es, solche Stereotype aktiv zu erkennen und ihnen frühzeitig vorzubeugen. Hochschulen tragen als Bildungs- und Arbeitsorte eine besondere Verantwortung, ein diskriminierungssensibles und inklusives Umfeld zu schaffen, in dem sich alle Studierenden und Mitarbeitenden – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung – sicher und respektiert fühlen (Heitzmann 2024).
1. Sensibilisierung durch Bildung und Schulung:
Workshops und Fortbildungen für Lehrende, Verwaltungspersonal und Studierende helfen, eigene unbewusste Denkmuster zu erkennen und zu hinterfragen.
 Good Practice:
Good Practice:
Die Universität Kiel organisiert jährlich die „Diversity Days“ mit Workshops, Vorträgen und Trainings zur Sensibilisierung und Weiterbildung aller Hochschulangehörigen. Die Veranstaltungen richten sich gezielt an Mitarbeitende und Studierende und werden in Kooperation mit anderen Hochschulen durchgeführt, um Ressourcen zu bündeln und Wirkung zu verstärken (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2024).2. Inklusion queerer Perspektiven fördern:
Queere Themen und Perspektiven sollten auch in Entscheidungsmechanismen integriert werden, nicht nur in Nischenfächern und an Aktionstagen.
 Good Practice:
Good Practice:
Die Freie Universität Berlin integriert queere Perspektiven systematisch in ihre Lehrveranstaltungen und Entscheidungsstrukturen, etwa durch das Queer Staff Netzwerk „Queer@FU“ (Freie Universität Berlin 2024).3. Strukturen für Diskriminierungsschutz stärken:
Vertrauliche Anlaufstellen für queere Studierende und Mitarbeitende, z. B. Gleichstellungsbüros oder Diversity-Beauftragte, sollten gut erreichbar und bekannt sein. Ein klarer Verhaltenskodex gegen Diskriminierung und ein niedrigschwelliger Beschwerdemechanismus schaffen Sicherheit.
 Good Practice:
Good Practice:
Die Universität Osnabrück bietet eine zentrale Anlaufstelle für Antidiskriminierung sowie individuelle Beratung für queere Studierende und Mitarbeitende an. Die Diversity-Koordination ist sichtbar auf der Hochschulwebsite platziert und informiert transparent über Beschwerdewege und Unterstützungsangebote (Universität Osnabrück 2025). -

Übung 20 (Modul 4.5)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 20 (Modul 4.5) im Workbook.
-
Sexuelle Orientierung x Nationalität & Migrationsgeschichte
Sexuelle Orientierung und Migrationsgeschichte oder nationale Herkunft sind zentrale Dimensionen von Vielfalt, die sich gegenseitig beeinflussen können. Wer queer ist und zugleich eine Migrationsgeschichte hat, erlebt häufig unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen – manchmal Offenheit, manchmal Tabus oder sogar Sanktionen.
In einem kurzen Video erzählt Ibrahim, wie er in seiner Heimat Libanon aufgrund seiner sexuellen Orientierung verfolgt wurde. Sein Ökonomiestudium musste er nach zwei Semestern abbrechen, nachdem er wegen angeblicher „homosexueller Handlungen“ festgenommen worden war. Die Vorstrafe machte es ihm unmöglich, eine reguläre Arbeit zu finden, sodass er sich mit Gelegenheitsjobs als Hilfskoch über Wasser hielt. Ein schwerer Angriff – ein Mann stieß ihn aus einem dritten Stockwerk eines Hause – veränderte alles und nach langer Genesung blieb ihm nur die Flucht. Das kurze Video erzählt von Ibrahims Neubeginn in Deutschland: In Köln erlebt er zum ersten Mal ein Leben ohne Angst.
Schauen Sie sich das Video an:
https://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/homosexualitaet/223555/schwul-verfolgt-geflohen/ -

Übung 21 (Modul 4.5)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 21 (Modul 4.5) im Workbook.
-
An Hochschulen treffen verschiedene Erfahrungen aufeinander: Studierende aus Ländern, in denen queeres Leben kriminalisiert oder gesellschaftlich geächtet wird, begegnen hier einer Umgebung, die nach außen hin tolerant wirkt, aber im Alltag oft von Stereotypen, Diskriminierung oder Unsicherheiten geprägt ist. Ein Coming-out kann an der Universität befreiend wirken, im familiären Umfeld jedoch mit Angst oder Loyalitätskonflikten verbunden sein.
Auch Sprache und kulturelle Konzepte spielen eine Rolle. Nicht in allen Sprachen gibt es Entsprechungen zu Begriffen wie queer oder pansexuell, und manche Identitätskategorien werden je nach Kontext ganz unterschiedlich verstanden. Solche Unterschiede verdeutlichen, dass sexuelle Orientierung keine universelle, sondern eine sozial und kulturell eingebettete Dimension ist.
Eine diversitätssensible Hochschule erkennt diese Komplexität an. Sie schafft Zugänge und Unterstützungsangebote für Studierende, die mehrfach marginalisiert sind, etwa durch diskriminierungssensible Beratung, internationale Vernetzungsinitiativen oder mehrsprachige Informationen. Ziel ist eine Lernumgebung, in der sich queere Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte gleichermaßen sicher und respektiert fühlen.
-
„Take away“ und Challenge
Sexuelle Orientierung beschreibt, zu welchen Geschlechtern sich ein Mensch emotional, romantisch und/oder sexuell hingezogen fühlt.
Sexuelle Orientierung ist Teil der persönlichen Identität und kann sich im Laufe des Lebens verändern oder weiterentwickeln.
Gleichstellung ist ein Prozess. Die Rechte queerer Menschen wurden erkämpft – doch rechtliche, gesellschaftliche und institutionelle Hürden zeigen, dass der Weg zu echter Gleichberechtigung noch nicht abgeschlossen ist.
Hochschulen tragen Verantwortung, sichere, respektvolle und inklusive Räume zu schaffen, in denen queere Studierende und Mitarbeitende sichtbar und geschützt sind.
Wissen schafft Sicherheit. Wer Begriffe, Lebensrealitäten und Herausforderungen queerer Menschen kennt, kann bewusster, offener und respektvoller agieren.

Challenge Sexuelle Orientierung:
Beobachten Sie Ihr eigenes Arbeitsumfeld in den kommenden Wochen:
- Wo werden queere
Lebensrealitäten sichtbar, in der Kommunikation, in Projekten oder in der
Hochschulkultur?
- Welche kleinen Schritte könnten Sie selbst unternehmen, um mehr Offenheit, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit für queere Identitäten zu fördern?
-
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien - Fibel Echte Vielfalt - https://echte-vielfalt.de/aufklaerung-und-bildung/fibel-echte-vielfalt/
Die Rainbow Map Europe - https://rainbowmap.ilga-europe.org
LSBTIQ Lexikon der Bundeszentrale für Politische Bildung https://www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/geschlechtliche-vielfalt-trans/245426/lsbtiq-lexikon/
Pride Flag – Doku HD – ARTE -
- Fibel Echte Vielfalt - https://echte-vielfalt.de/aufklaerung-und-bildung/fibel-echte-vielfalt/
-
-
-
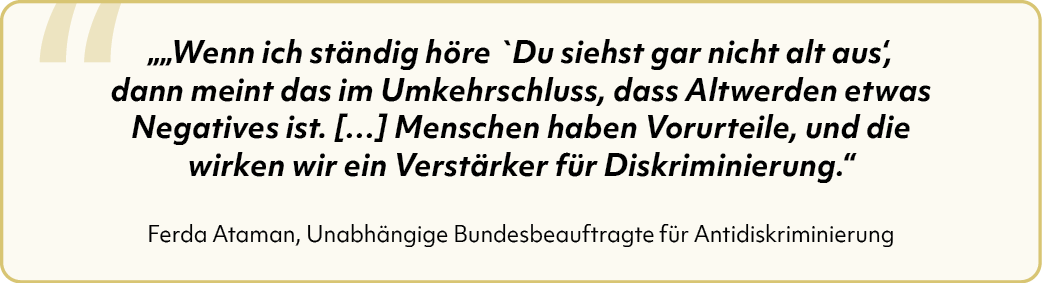
-
In einer zunehmend vielfältigen Arbeitswelt sind die Anerkennung und Wertschätzung der verschiedenen Diversitätsdimensionen von großer Bedeutung. Das Alter ist dabei eine komplexe, sichtbare Dimension, denn sie umfasst Lebenserfahrungen, unterschiedliche Perspektiven und Herausforderungen. In der Hochschule reicht die Altersspanne häufig von jungen Berufseinsteigerinnen bis hin zu erfahrenen Mitarbeitenden kurz vor ihrer Rente. Altersdiversität eröffnet beispielsweise durch Wissenstransfer und unterschiedliche Sichtweisen Chancen und stellt Organisationen auch vor Herausforderungen, etwa im Hinblick auf Kommunikation und Teamdynamik. Der Umgang damit beeinflusst das tägliche Miteinander maßgeblich.
-
Das Alter ist multidimensional
Wenn wir über Alter sprechen, scheint auf den ersten Blick klar, dass es sich um eine Zahl handelt. Doch bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Alter ist ein multidimensionaler Prozess, der weit über die bloße Anzahl an Lebensjahren hinausgeht. Es umfasst biologische, psychologische und soziale Aspekte (Müller 2020).
-
Unbewusste Altersvorurteile
Franciska Krings und Annette Kluge (2022: 153) stellen die Besonderheit der Dimension Alter im Vergleich zu den anderen Diversitätsdimensionen fest: „Der Alterungsprozess transformiert jeden von uns zwangsläufig, und so wechseln wir automatisch von der Gruppe der Jungen zur Gruppe der Alten. Die Art und Weise, wie wir ältere Menschen wahrnehmen, deutet also darauf hin, wie wir unsere eigene Zukunft wahrnehmen.“
-

Übung 22 (Modul 4.5)
Nehmen Sie sich Zeit für die Übung 22 (Modul 4.5) im Workbook.
-
Diese Übung hilft Ihnen dabei, eigene unbewusste Altersassoziationen zu erkennen und zu reflektieren. Denn oft verbinden wir bestimmte Verhaltensweisen automatisch mit einem bestimmten Alter, ohne es zu merken.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt den Begriff Ageism (Ageismus), der aus dem englischsprachigen Raum stammt, als „Stereotype (wie wir denken), Vorurteile (wie wir fühlen) und Diskriminierung (wie wir handeln) gegenüber anderen oder sich selbst aufgrund des Alters“ (WHO o.J.). Dabei richtet sich Ageismus nicht nur gegen ältere Menschen, sondern kann ebenso jüngere Erwachsene oder Kinder betreffen. Altersstereotype beruhen darauf, dass Individuen allein aufgrund ihres Alters bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben werden, ohne dass empirische Befunde oder die tatsächlichen Sichtweisen und Erfahrungen der Betroffenen berücksichtigt werden. Solche Zuschreibungen können positive wie negative Folgen haben: Während vorteilhafte Annahmen die Leistungsfähigkeit und die Bindung von Beschäftigten im Arbeitsumfeld stärken können, führen negative Erwartungen häufig zu Demotivation oder sogar zu einem vorzeitigen Austritt aus bestehenden Arbeitsverhältnissen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Ageismus trägt dazu bei, altersbezogene Benachteiligungen sichtbar zu machen und deren Auswirkungen besser zu verstehen. Gleichzeitig fördert sie eine kritischere Haltung gegenüber gängigen Vorstellungen über verschiedene Altersgruppen und kann dazu anregen, bisher als selbstverständlich angenommene Bilder von jüngeren wie älteren Mitarbeitenden zu hinterfragen und neu zu bewerten, was langfristig zu einem Wandel etablierter Normen beitragen kann (Kaiser 2023: 47 f.).
-
Generationen
Wenn wir über das Alter sprechen, werden häufig auch Generationenlabels thematisiert: Generation Z, Millennials, Babyboomer... Diese Begriffe sind in Medien, in der Arbeitswelt, im Marketing allgegenwärtig.Womit sind Sie aufgewachsen?

Oft hört man Aussagen wie: Achtung - bewusste Reproduktion! → „Die Gen Z will nicht mehr arbeiten“ „Die Gen Z ist extrem umweltbewusst“→ „Boomer verstehen keine neuen Technologien“ / „Boomer sind loyal und beständig“
Achtung - bewusste Reproduktion! → „Die Gen Z will nicht mehr arbeiten“ „Die Gen Z ist extrem umweltbewusst“→ „Boomer verstehen keine neuen Technologien“ / „Boomer sind loyal und beständig“
→ „Millennials sind alle ständig überfordert“ / „Millennials sind technikaffin“Diese negativen wie positiven Merkmale dienen dazu, Personen anhand ihres Geburtsjahres sowie typischer Werte, Einstellungen und Verhaltensweisen bestimmten Generationsgruppen zuzuweisen (Kaiser 2023: 20 f.). Generationen werden häufig in sogenannte Generationscluster oder -kohorten eingeteilt. Grundlage dafür ist, dass Personen einer Generation bestimmte gemeinsame Merkmale aufweisen: zum einen ein Geburtszeitraum, der üblicherweise etwa 15 Jahre umfasst, und zum anderen in der Jugendzeit prägende gesellschaftliche Ereignisse oder technologische Entwicklungen, die sie erlebt haben. Die Benennung solcher Generationen erfolgt teils aufgrund historisch bedeutsamer Entwicklungen, wie etwa die Bezeichnung »Babyboomer« für die in den 1960er-Jahren geburtenstarken Jahrgänge. Darüber hinaus werden alphabetische Bezeichnungen genutzt, die mit der Generation Alpha (α) fortgeführt wurden.
Die Grundlage dieser Sichtweise stammt von Karl Mannheim, der als Soziologe mit seinem Generationenkonzept im Jahr 1928 die Idee formulierte, dass Menschen einer Generation im Jugendalter ähnliche Erfahrungen teilen und dadurch ähnliche Sichtweisen entwickeln. Dieses Konzept ist aus heutiger Sicht umstritten, da zeitgleich geborene Menschen, einerseits unterschiedlich auf epochale Ereignisse reagieren, aber auch weil neben Alter weitere Diversitätsdimensionen, wie soziale Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung etc. einwirken. Ziemann (2020) benennt als anschauliches Beispiel in seiner Kritik am Begriff hierbei die „Frontgeneration“, die in der Erklärung Mannheims allein bürgerliche Männer darstellt und Personen mit weiteren Diversitätsdimensionen, die zu Kriegszeiten völlig andere Lebensrealitäten hatten, ausblendet. Andererseits werden diese Personen dennoch durch unterschiedliche Ereignisse geprägt und das nicht allein im Jugendalter, das Zeitfenster, auf das sich der Soziologe stützt.
Auch hier greifen also die im vorherigen Kapitel beschriebenen Stereotype und Vorurteile, die, wie vorherige Module gezeigt haben, gesellschaftlich konstruiert und aus wissenschaftlicher Sicht nur begrenzt aussagekräftig sind: Nicht alle Individuen einer Generation teilen dieselben Erfahrungen oder zeigen die gleichen charakteristischen Eigenschaften (Atteneder 2017: 60 f.). Oder wie Ziemann formuliert: „Generationen sind in erster Linie jedoch Identitätskonstruktionen, die bestimmte Alterskohorten in der Gesellschaft sichtbar machen und Individuen die Möglichkeit bieten, ihre eigene Lebensgeschichte vor diesem Hintergrund zu deuten und zu reflektieren“ (Ziemann 2022).
Generationen Übersicht
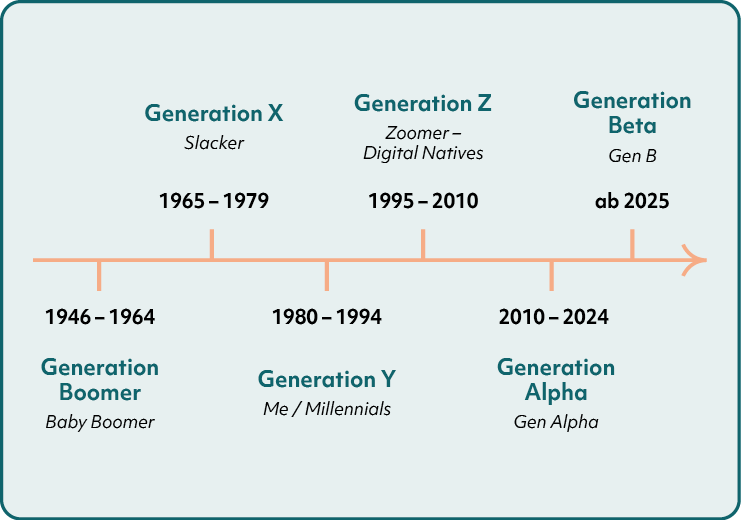
Statt Menschen also in Schubladen wie Gen Z oder Boomer zu stecken, wäre es hilfreicher, genauer hinzuschauen:
- In welcher Lebensphase befindet sich die Person gerade?
- Welche Werte sind dieser Person wichtig?
- Und wie beeinflusst der gesellschaftliche Kontext ihre Sicht auf Arbeit, Familie oder Freizeit?
Generationenklischees machen es uns leicht, greifen aber zu kurz. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie Menschen denken, fühlen und leben, dann müssen wir gemeinsam über individuelle Lebensrealitäten sprechen und nicht über Geburtsjahrgänge.
-
Alter x Nationalität & Migrationsgeschichte
Im Verlauf dieses Kurses haben Sie bereits an vielen Stellen erfahren, dass Diversitätsdimensionen nicht isoliert voneinander betrachtet werden können. Studien (z.B. Hagelskamp/ Bonnen 2022) deuten darauf hin, dass gerade im Hochschulkontext weitere Aspekte, wie Elternschaft, Berufserfahrung oder Lebensumstände, wie die (Un-)Abhängigkeit vom Elternhaus, Einflüsse auf Kategorisierungen und damit auch auf Gruppierungen unter Studierenden haben. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel auch Alter und Nationalität/ Migrationsgeschichte auf besondere Weise aufeinander wirken. Damit zeigt die vermeintlich enge Altersspanne von 18 bis Anfang 30 im Hochschulbereich eine spezifische Form der Altersdiversität (Hagelskamp/Bonnen 2022: 110).
 Ein fiktives Beispiel:
Ein fiktives Beispiel:
Farah ist 42 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem Libanon und ist vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. In ihrer Heimat hat sie bereits ein Studium der Soziologie abgeschlossen, konnte aber aufgrund der politischen Lage viele Jahre nicht in ihrem Beruf arbeiten.
Jetzt lebt sie in einer deutschen Großstadt und hat sich entschieden, noch einmal ein Masterstudium in interkultureller Kommunikation an einer deutschen Universität zu beginnen - ein lang gehegter Wunsch, den sie sich endlich erfüllt. Doch der Studienalltag stellt Farah vor einige Herausforderungen. In Seminaren wird sie oft als Dozentin oder externe Besucherin angesehen, nie automatisch als Kommilitonin. Einige jüngere Studierende reagieren irritiert oder sogar mit herablassenden Bemerkungen („Sie müssen das doch gar nicht mehr machen, oder?“).
Auch wenn Farah gut deutsch spricht, ist sie oft unsicher bei Fachbegriffen oder in der Umgangssprache. Manche Mitstudierende wechseln bei Gruppenarbeiten in die englische Sprache, nicht aus Höflichkeit, sondern aus der Annahme heraus, sie könne „sowieso kein richtiges Deutsch“. Farahs Vorwissen wird oft übersehen oder in Zweifel gezogen („Wie aktuell kann ein Soziologieabschluss, der 20 Jahre alt ist, schon sein und dann auch noch aus dem Libanon?“). Ihre Perspektiven, etwa zur Rolle von Migration oder Mehrsprachigkeit, werden selten ernsthaft nachgefragt.
Während viele junge Studierende schnell Freundschaften schließen oder über soziale Medien in Kontakt kommen, fühlt sich Farah oft außen vor. Die fehlende generationsübergreifende Offenheit erschwert es ihr, Anschluss zu finden.Reflexionsfragen
- Welche Barrieren
erlebt Farah im Hochschulalltag?
-
Gibt es an Ihrer
Hochschule bereits Maßnahmen, die ein inklusives Umfeld und
generationsübergreifende Teilhabe fördern? Welche weiteren Maßnahmen können
Hochschulen ergreifen?
- Gibt es Maßnahmen, die Sie in Ihrem Arbeitsumfeld ergreifen könnten, um dieser Ausgeschlossenheit von älteren Studierenden (mit Migrationshintergrund) entgegenzuwirken?
- Welche Barrieren
erlebt Farah im Hochschulalltag?
-
„Take away“ und Challenge
Alter ist eine komplexe, sichtbare und oft unterschätze Diversitätsdimension.
Die Einteilung in Generationen ist gesellschaftlich wirksam, aber wissenschaftlich nicht tragfähig.
Einstellungen, Werte und Wünsche entstehen nicht durch das Geburtsjahr, sondern durch Lebensphasen, Erfahrungen und den Wandel der Zeit.
Altersstereotype und Vorurteile können zu Ungleichbehandlung und Diskriminierung führen, wenn sie nicht hinterfragt werden.
Die Herausforderung für Hochschulen und die Arbeitswelt besteht darin, unbewusste Vorurteile bewusst aufzudecken und altersinklusivere Räume zu gestalten, in denen Teilhabe und Austausch möglich ist.

Challenge Alter:
Achten sie in den kommenden Wochen bewusst darauf, wie über die Dimension Alter gesprochen wird – in Ihrem Team, in der Universität, in den Medien und ihrem erweiterten Umfeld. Was fällt Ihnen auf? -
 Zusatzmaterialien
Zusatzmaterialien Deutschlandfunk Kultur (2023). Mythos Generationenkonflikt: Die drei hartnäckigsten Vorurteile: https://www.aok.de/pk/magazin/sport/fit-im-alter/das-biologische-alter-wie-alt-bin-ich-wirklich/, zuletzt geprüft am 28.11.2025.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2022). Kampagne der ADS zu #ageism Kampagne 1-7: https://www.youtube.com/@antidiskriminierungsstelle/shorts, zuletzt geprüft am 02.12.2025.
-
-
-
Im folgenden Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, zentrale Inhalte des Kurses noch einmal aufzugreifen und zu reflektieren. Das Quiz dient dazu, Ihr Verständnis der behandelten Themen zu überprüfen und die wichtigsten Aspekte zu festigen.
-
 Herzlichen Glückwunsch!Sie haben den Selbstlernkurs abgeschlossen und sich mit zentralen Aspekten von Interkulturalität und Diversity im Hochschulkontext auseinandergesetzt. Die Inhalte bieten Anregungen zur Reflexion des eigenen Handelns und zur Weiterentwicklung im beruflichen Alltag. Interkulturelle und Diversity-Kompetenzen entstehen nicht punktuell, sondern durch kontinuierliche Aufmerksamkeit, Praxis und Austausch. Wir laden Sie ein, die Impulse aus dem Kurs in Ihre Arbeit an der FSU mitzunehmen und weiterzudenken.
Herzlichen Glückwunsch!Sie haben den Selbstlernkurs abgeschlossen und sich mit zentralen Aspekten von Interkulturalität und Diversity im Hochschulkontext auseinandergesetzt. Die Inhalte bieten Anregungen zur Reflexion des eigenen Handelns und zur Weiterentwicklung im beruflichen Alltag. Interkulturelle und Diversity-Kompetenzen entstehen nicht punktuell, sondern durch kontinuierliche Aufmerksamkeit, Praxis und Austausch. Wir laden Sie ein, die Impulse aus dem Kurs in Ihre Arbeit an der FSU mitzunehmen und weiterzudenken.
-
-
-
Aktion Mensch o.J.: Begriffsdefinition: Beeinträchtigung oder Behinderung? https://www.aktion-mensch.de/inklusion/recht/hintergrundwissen/definition-beeintraechtigung-behinderung, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Aktion Mensch (2024). Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. https://www.aktion-mensch.de/inklusion/studien/umsetzung-unbrk-internationaler-vergleich, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Allbright-Bericht (2024). Mind the Gap: Deutschland bleibt beim Frauenanteil im Top-Management weit hinter Großbritannien.
Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge: Addison-Wesley.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2024). Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 04.11.2025.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2025). Altersdiskriminierung erkennen, verstehen, begegnen: Kurzstudie und Handlungsempfehlungen. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Umfragen/20250324-Altersdiskriminierung-Kurzstudie.pdf?__blob=publicationFile&v=3, zuletzt geprüft am 02.12.2025.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2025). Was ist Inklusion?. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/faqs/DE/behinderung/03_was_ist_inklusion.html, zuletzt geprüft am 04.11.2025.
Atteneder, Helena (2017). Mediale Konstruktionen von Alter und Generation. Erkenntnisse einer transdisziplinären Stereotypenforschung. München: kopaed.
Bargel, Holger/Bargel, Tino (2010). Ungleichheiten und Benachteiligungen im Hochschulstudium aufgrund der sozialen Herkunft der Studierenden, Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
Barmer (o.J). Psychische Gesundheit: Neurodiversität: Ist Anderssein normal? https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/psyche/psychische-gesundheit/neurodiversitaet-1300456, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Bergmann U. et al. (2013). Die Zitronenübung: Interkulturelle Sensibilisierung für Stereotypen und Vorurteile. Interculture TV:
, zuletzt geprüft am 04.11.2025.Blossfeld, Pia N. et al. (2015). „Educational Expansion and Inequalities in Educational Opportunity: Long-Term Changes for East and West Germany“, in: European Sociological Review 31/2, S.114-160.
bmbfsfj (2025). Unbezahlte Sorgearbeit: Gender Care Gap – ein Indikator für die Gleichstellung. https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/themen/gleichstellung/gender-care-gap/indikator-fuer-die-gleichstellung/gender-care-gap-ein-indikator-fuer-die-gleichstellung-137294, zuletzt geprüft am 10.11.2025.
Bolten, J. (2019). Stereotypenverwendung in der Werbung und das Konzept der Multiple Identities – ein Widerspruch? In: Janich, N. (Hrsg.): Stereotype in Marketing und Werbung, S.29-46. Wiesbaden: Springer VS.
Bundesagentur für Arbeit (2025). Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2024. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Menschen-mit-Behinderungen/generische-Publikation/Arbeitsmarktsituation-schwerbehinderter-Menschen.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Bundesministerium Arbeit und Soziales (2025). Teilhabe: Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. https://www.bmas.de/DE/Soziales/Teilhabe-und-Inklusion/Politik-fuer-Menschen-mit-Behinderungen/Beschaeftigung-schwerbehinderter-Menschen/beschaeftigung-schwerbehinderter-menschen.html#:~:text=Alle%20privaten%20und%20öffentlichen%20Arbeitgeber,(%20§%20154%20SGB%20IX%20), zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2021). „Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22.Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021“, URL: https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/4/31790_22_Sozialerhebung_2021.html
Bundesministerium für Gesundheit (2020): „Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen“, URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konversionstherapienverbot.html
Charta der Vielfalt (2025). Factbook Diversity 2024: Positionen, Zahlen, Argumente. Berlin: Charta der Vielfalt e.V.
CHE Hochschuldaten (2025). Studienabschlüsse in Deutschland. https://hochschuldaten.che.de/deutschland/studienabschluesse/, zuletzt geprüft am 11.11.2025.
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (2024). „Zusammenarbeit über Grenzen hinweg für ein vielfältiges und inklusives Europa“, URL: https://www.uni-kiel.de/de/international/sea-eu/detailansicht/news/zusammenarbeit-ueber-grenzen-hinweg-fuer-ein-vielfaeltiges-und-inklusives-europa
Deutscher Bundestag (2017). „Recht. Mehrheit im Bundestag für die ‚Ehe für alle‘“, URL: https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2017/kw26-de-ehe-fuer-alle-513682
Deutsches Institut für Sozialwirtschaft (2021). „20 Jahre eingetragene Lebenspartnerschaft“, URL: https://echte-vielfalt.de/lebensbereiche/lsbtiq/lesben/20-jahre-eingetragene-lebenspartnerschaft/
Deutschlandfunk (2009). „Warum haben alle Kulturen eine Religion entwickelt“, URL: https://www.deutschlandfunk.de/warum-haben-alle-kulturen-eine-religion-entwickelt-100.html
Deutschlandfunk (2023). „Bundesverwaltungsgericht. Kreuzerlass in Bayern hat Bestand – Söder zufrieden“, URL: https://www.deutschlandfunk.de/kreuzerlass-in-bayern-hat-bestand-soeder-zufrieden-100.html
Deutschlandfunk (2023). „Die verurteilten ‚175er‘- Der lange Kampf für die legale homosexuelle Liebe“, URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-paragraf-175-homosexualitaet-100.html
Deutschlandfunk (2024). „Pfingsten, Fronleichnam & Co. Sind christliche Feiertage noch zeitgemäß?“, URL: https://www.deutschlandfunk.de/feiertage-religioes-christlich-zeitgemaess-saekular-100.html
Destatis (2023). Gesundheit: Behinderte Menschen. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/_inhalt.html, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Destatis (2024). Zahl der Woche: Gut 3800 Studierende waren zuletzt jünger als 18 Jahre. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2024/PD24_14_p002.html, zuletzt geprüft am 03.12.2025.
Eichstedt, Astrid/ Wulff, Stefanie (2023). Meilensteine der Behindertenrechtsbewegung. https://www.aktion-mensch.de/inklusion/recht/hintergrundwissen/behindertenrechtsbewegung, zuletzt geprüft am 27.11.2025.
EUTB (o.J.). Ableismus. https://www.teilhabeberatung.de/woerterbuch/ableismus, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
fowid (2024). „Religionszugehörigkeiten 2024“, Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland, URL: https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2024
Freie Universität Berlin (2024). „Queer@FU“, URL: https://www.fu-berlin.de/sites/diversity/diversity-fu/staff_networks/queer_FU/index.html
Frenkel-Brunswik, E. (1949). Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptual Personality Variable. In: Journal of Personality 18(1), S. 108-143.
Frohn, D./ Meinhold, F./ Schmidt, C. (2017). Studie „Out im Office?!“ Sexuelle Identität und Geschlechtsidentität. Berlin: Antidiskriminierungsstelle des Bundes und Köln: Institut für Diversity und Antidiskriminierungsforschung.
Fuchs, Petra (2023). ‚Behinderung‘ und der Umgang mit behinderten Menschen in historischer Perspektive. https://www.bpb.de/themen/inklusion-teilhabe/behinderungen/521593/behinderung-und-der-umgang-mit-behinderten-menschen-in-historischer-perspektive/, zuletzt geprüft am 27.11.2025.
Gardenswartz, Lee/ Rowe, Anita (2008). Diverse Teams at work: Capitalizing on the Power of Diversity. Alexandria, Virginia: Society for Human Resource Management.
Gaucher, D., Friesen, J., & Kay, A. C. (2011). Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality. Journal of Personality and Social Psychology, 101(1), 109-128.
Gilovich, T., Griffin, D., Kahneman, D. (2002). Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge: Cambridge University Press.
Hagelskamp, Carolin/ Bonnen, Mechthild (2022). Altersdiversität im Studienalltag: Eine vernachlässigte Dimension von Vielfalt unter Studierenden? In: Beiträge zur Hochschulforschung (4/2022), S. 102-113.
Harris, M. (1999). Theories of Culture in Postmodern Times. Walnut Creek: Rowman Altamira.
Heitzmann, D. (2024). Einen Unterschied machen. Diversitäts- und Antidiskriminierungspolitiken an deutschen Hochschulen. In: Le Breton, M., Burren, S., Bachmann, S. (Hrsg.). Differenzkritische Perspektiven auf Fachhochschulen und Universitäten. Beiträge zur Regional- und Migrationsforschung, S.47-66. Springer VS, Wiesbaden.
Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations. Software of the Mind. London et al.: McGraw-Hill.
Jäkh, S. (2024): Queer Theory/Sexuelle Identität als Forschungsgegenstand. In: Normalisierung von männlicher Homosexualität. BestMasters, S.9-17. Springer VS, Wiesbaden.
Junker, N.M., Hernandez Bark, A.S., Heimrich, J. (2022). Stereotype und Vorurteile, der Social Identity Approach und Intergruppenkontakt. In: Genkova, P. (eds) Handbuch Globale Kompetenz. Wiesbaden: Springer Gabler.
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Kaiser, Dieter (2023). Generationsdivers führen: Praxisbuch für junge Führungskräfte. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.
Kessler, Eva-Marie/ Warner, Lisa Marie (2023). Age ismus: Altersbilder und Altersdiskriminierung in Deutschland. Berlin: Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Kratz, Fabian et al. (2022). „At Which Age is Education the Great Equalizer? A Causal Mediation Analysis of the (In-)Direct Effects of Social Origin over the Life Course“, in: European Sociological Revue 38/6, S.866-881.
Kretzenbacher, H. L. (1992). Der „erweiterte Kulturbegriff“ in der außenkulturpolitischen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland. Ein Vergleich mit der öffentlichen/innenkulturpolitischen und kulturwissenschaftlichen Begriffsentwicklung von den sechziger bis zu den achtziger Jahren. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18, S.170-196.
Krings, F./ Kluge A. (2022). Altersvorurteile. In: Petersen, L.-E./ Six, B. (Hrsg.): Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen. S: 153-161. Weinheim Basel: Beltz.
Legal Tribune Online (2025). „Neutralitätsgebot über Religionsfreiheit Weiteres OLG verbietet Schöffin das Kopftuchtragen“, URL: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/1ogs125-olg-braunschweig-neutralitaetsgebot-religionsfreiheit
Leidmedien (2017). Tapferkeit, Leid und Heldentum: Klischees in den Medien. https://leidmedien.de/negative-beispiele/, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Link, Christiane (2016). Vortrag: „Behindert ist man nicht, behindert wird man". https://www.zeit.de/video/2016-09/5111872335001/z2x-behindert-ist-man-nicht-behindert-wird-man, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Lüsebrink, H.-J. (2016). Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. 4., akt. und erw. Auflage. Stuttgart: J.B. Metzler.
Mafaalani, Aladin el- (2021). Mythos Bildung. Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Mit einem Zusatzkapitel zur Corona-Krise. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns (o.J.). Wie kann man das biologische Alter messen? https://www.age.mpg.de/was-ist-das-biologische-alter, zuletzt geprüft am 01.12.2025.
Moghaddam, F.M., Covalucci, L. (2016). Macro, Meso, and Micro Creativity: The Role of Cultural Carriers. In: Glăveanu, V. (Hrsg.). The Palgrave Handbook of Creativity and Culture Research. Palgrave Studies in Creativity and Culture, S.721-741. Palgrave Macmillan, London.
Müller, Britta (2020). Höheres und hohes Alter. In: Deinzer R./von dem Knesebeck O. (Hrsg.). Online Lehrbuch der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie. Berlin: German Medical Science GMS
Murray D. et al. (2019). „Author-Reviewer Homophily in Peer-Review.“ In: BioRxiv 400515, doi: https://doi.org/10.1101/400515
Myability (o.J.). Inklusives Wording. https://www.myability.org/wissen/wissens-blog/inklusion-unternehmen/erfolgsfaktoren/inklusives-wording, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Pickel, Gert (2024). Religion. In: Kopp, Johannes/Steinbach, Anja (Hrsg.): Grundbegriffe der Soziologie. Wiesbaden: Springer VS.
Prutek, K., Grabe, S.M. (2024). Kulturanalyse anhand des Kultureisbergs. In: Hiller, G.G., Zillmer-Tantan, U., Fattohi, R. (Hrsg.) Interkulturelle Kompetenz online vermitteln. Key Competences for Higher Education and Employability, S.263-268. Wiesbaden: Springer VS.
Rötting, Martin (2014). „Postsäkulare Universität? Religiöse Vielfalt an Hochschulen“, in: Die Hochschule: Journal für Wissenschaft und Bildung 23/2, S.77-87.
Schwab, Henrike (2024). Barrierefreiheit: Eine Hochschule für alle? https://www.forschung-und-lehre.de/management/eine-hochschule-fuer-alle-6490, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
Statista (2025). Anzahl der Einwohner in Deutschland nach Generationen am 31. Dezember 2024. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1130193/umfrage/bevoelkerung-in-deutschland-nach-generationen/, zuletzt geprüft am 02.12.2025.
Statista (2025b). Anzahl der Studierenden an Hochschulen nach Alter in Deutschland im Wintersemester 2024/25. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1166109/umfrage/anzahl-der-studenten-an-deutschen-hochschulen-nach-alter/, zuletzt geprüft am 03.12.2025.
Statista (2025). Frauenanteil in der Professorenschaft in Deutschland im Jahr 2024 nach Hochschulart. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/479858/umfrage/frauenanteil-in-der-professorenschaft-nach-hochschulart/#:~:text=Frauenanteil%20in%20der%20Professorenschaft%20in%20Deutschland%20nach%20Hochschulart%202024&text=Die%20Statistik%20zeigt%20den%20Frauenanteil,in%20der%20Professorenschaft%20in%20Deutschland, zuletzt geprüft am 12.11.2025.
Statista (2025). „Religionen in Deutschland“, URL: https://de.statista.com/themen/125/religion/#topicOverview
Statistisches Bundesamt (Destatis) (2024). Hochschulen: Frauenanteile nach akademischer Laufbahn. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/frauenanteile-akademischelaufbahn.html, zuletzt geprüft am 11.11.2025.
Statistisches Bundesamt (Destatis), (2025a). Verdienste: Gender Pay Gap. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-GenderPayGap/_inhalt.html, zuletzt geprüft am 10.11.2025.
Statistisches Bundesamt (Destatis), (2025b). Studierende: Deutschland, Semester, Nationalität, Geschlecht, Studienfach.
Statistisches Bundesamt (Destatis) (2025c). Gender Education Gap. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/04/PD25_N014_212.html, zuletzt geprüft am 11.11.2025.
Steinkühler, J. et al. (2023). Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3. Studieren mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung.Hannover: DZHW.
Steinpreis, Rhea/ Anders, Katie/ Ritzke, Dawn (1999). The Impact of Gender on the Review of the Curricula Vitae of Job Applicants and Tenure Candidates: A National Empirical Study. Sex Roles 41, 509–528.
Stifterverband (2021). Hochschulbildungsreport 2020. Vom Arbeiterkind zum Doktor, URL: https://hochschulbildungsreport.de/fokusthemen/arbeiterkinder
Straub, J.; Weidemann, A.; Weidemann, D. (Hrsg.) (2007). Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe – Theorien - Anwendungsfelder. Stuttgart: Metzler.
Trompenaars, F. (1993). Riding the waves of culture. Understanding Cultural Diversity in Business. London: Economist Books.
Universität Osnabrück (2025). „Antidiskriminierung“, URL: https://www.uni-osnabrueck.de/campusleben/chancengleichheit/antidiskriminierung
Universität Potsdam (o.J.) Podcast mit Ly Tran, Studentin der Linguistik an der Universität Potsdam. https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusive-hochschule/Podcasts__Wir_sind_UP_/podcast_transkript_tran.pdf, zuletzt geprüft am 25.11.2025.
UN Women (2025). Gender Gaps in Deutschland. (https://unwomen.de/gender-gaps-in-deutschland/, zuletzt geprüft am 03.06.2025.
Vedder, G. (2019). Lookismus als Unconscious Bias: Der Einfluss des Aussehens auf Personalentscheidungen. In: (Domsch, Michel/ Ladwig, Désirée/Weber, Florian (Hrsg.): Vorurteile im Arbeitsleben: Unconscious Bias erkennen, vermeiden und abbauen, S. 103-114. Wiesbaden: Springer Gabler.
Vedder, G. (2022). Unbewusste Vorurteile bei der Personalauswahl. In: Vedder, Günther/ Krause, Florian (Hrsg.): Vielfalt in der Arbeitswelt, S. 1-13. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.1
Weichselbaumer, D. (2016). Discrimination against female migrants wearing headscarves (IZA Discussion Paper No. 10217). Bonn: Institute of Labor Economics (IZA).
Welsch, W. (1997). Transkulturalität. In: Universitas. Orientieren! Wissen! Handeln! Deutsche Ausgabe, Vol. 52 (607), S.16-24.
Welsch, W. (2017). Transkulturalität: Realität – Geschichte – Aufgabe. Wien: new academic press.
WHO (o.J.). Ageism. https://www.who.int/health-topics/ageism#tab=tab_1, zuletzt geprüft am 09.12.2025.
Zeutschel, U. (2016). „Zoomen“ zum Entdecken interkultureller Verständigungspotenziale und -Ressourcen. Interculture Journal: Online-Zeitschrift für interkulturelle Studien, Vol. 15 (26), S.93-96.
Ziemann, Benjamin (2020). Generationen im 20. Und 21. Jahrhundert: Zur Kritik eines problembeladenen Begriffs. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/generationen-2020/324485/generationen-im-20-und-21-jahrhundert/, zuletzt geprüft am 05.12.2025.
-

 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!