4. Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktion
4.1. Fragen zur Wirklichkeitskonstruktion
Diese Fragen beziehen sich auf verschiedene Aspekte:
a) Fragen zum Auftragskontext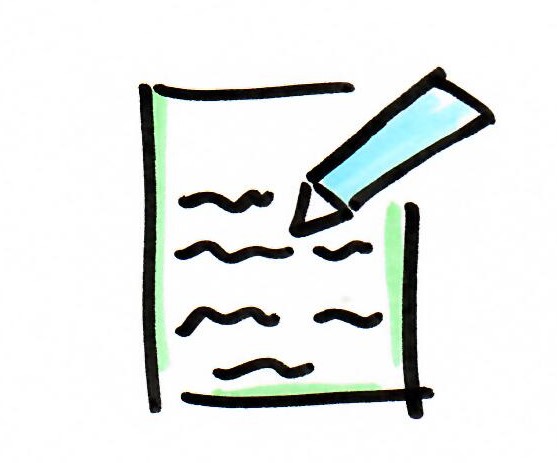
Hier
steht die Klärung der oft vielschichtigen und teils widersprüchlichen
Erwartungen im Fokus – sowohl der ausdrücklich formulierten als auch der
unausgesprochenen Aufträge aller beteiligten Personen. Häufig sind dies nicht
nur die direkt anwesenden Gesprächspartner, sondern auch Dritte, die in das
System eingebunden sind.
Für die Klärung dieser unterschiedlichen Erwartungen bieten sich zirkuläre Fragen an wie:
• Wer hatte die Idee zu diesem Kontakt? Was möchte er:sie, was hier passieren soll?
• Was denken Sie, verspricht Ihre Chefin sich von diesem Gespräch?
• Denken Sie, Ihre Wünsche und die Ihrer Kollegin stimmen überein, oder wie unterscheiden sie sich?
• Was müsste ich tun, damit das Coaching aus der Sicht Ihrer Chefin ein absoluter Misserfolg wird?
b) Fragen zum Problemkontext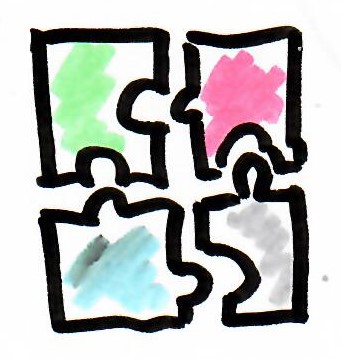
Nach
der Erörterung der Erwartungen kann das präsentierte Problem genauer betrachtet
werden. Es ist hilfreich, vage oder globale Problembeschreibungen durch
gezielte Fragen weiter zu differenzieren, um sie handhabbarer zu machen.
Hierbei wird gemeinsam mit den Beteiligten herausgearbeitet, welche konkreten
Verhaltensweisen oder Beschreibungen aus ihrer Sicht das Problem ausmachen. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf der unterschiedlichen Wahrnehmung der
Beteiligten.
Beispiele:
• Aus welchen Verhaltensweisen besteht das Problem?
• Wem wird dieses Problemverhalten gezeigt, wem nicht?
• Wo wird es gezeigt, wo nicht?
• Wann wird es gezeigt, wann nicht?
• Woran würden Sie erkennen, dass es gelöst ist?
• Wer hat es zuerst als Problem bezeichnet?
• Wer würde am ehesten bestreiten, dass es sich überhaupt um ein Problem handelt?
• Was müssten Sie tun, um Ihr Problem zu behalten oder zu verewigen oder zu verschlimmern?
• Was könnte ich / könnten wir tun, um Sie dabei zu unterstützen?
• Wie könnten die anderen Sie dabei unterstützen? Wie könnten die anderen Sie dazu einladen, es sich schlecht gehen zu lassen?
c) Interaktionskreisläufe erkunden
Sobald
Problemverhalten und relevante Kontexte eingegrenzt sind, kann untersucht
werden, in welche wiederkehrenden Interaktionsmuster das Verhalten eingebettet
ist. Wichtig ist dabei, dass alle Beteiligten sowohl als „Verursacher“ als auch
als „Betroffene“ dieser Dynamik erkannt werden. Ziel ist es, den Beteiligten
aufzuzeigen, wie sie selbst Teil dieser Muster sind und welche Konsequenzen ihr
Handeln im System hat.
• Wer reagiert am meisten auf das Problemverhalten, wer weniger? Wen stört es, wen nicht?
• Wie reagieren welche Anderen darauf?
• Wie reagiert das »Problemkind« auf die Reaktionen der anderen?
• Wie reagieren die anderen auf die Reaktionen des »Problemkindes«?
d) Erklärungen für das Problem reflektieren
Neben
der Erfassung der Interaktionsmuster spielen auch die individuellen Deutungen
des Problems eine zentrale Rolle. Jede Erklärung beeinflusst den Raum möglicher
Lösungen – sie kann diesen entweder erweitern oder einschränken. Daher ist es
sinnvoll zu erkunden, welche Erklärungen die Beteiligten für das Problem haben,
wie sich ihre Sichtweisen unterscheiden und welche praktischen Auswirkungen
diese Perspektiven mit sich bringen.
• Wie erklären Sie sich, dass das Problem entstanden ist?
• Was würde Ihre Vorgesetzte sagen, warum das Problem entstanden ist?
• Wie, dass es dann und dann auftritt und dann und dann nicht?
• Welche Folgen haben diese Erklärungen?
e) Bedeutung des Problems für die Beziehungen hinterfragen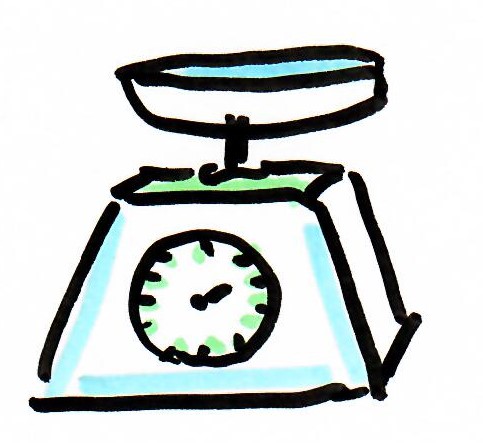
Hypothesen
über den „Nutzen“ oder die Funktion eines Problems im System können durch
gezielte Fragen sichtbar gemacht werden. Dabei kann untersucht werden, welche
Beziehungsveränderungen mit dem Beginn oder einem möglichen Ende des Problems
verbunden wären. Symptome werden im systemischen Ansatz häufig als Ausdruck von
Übergangsphasen innerhalb eines Systems verstanden.
• Was hat sich in den Beziehungen verändert, als das Problem begann?
• Was würde sich in den Beziehungen verändern, wenn das Problem wieder
aufhören würde?
*Die Fragen wurden übernommen aus Schlippe/Schweitzer 2019, S. 49-53.
